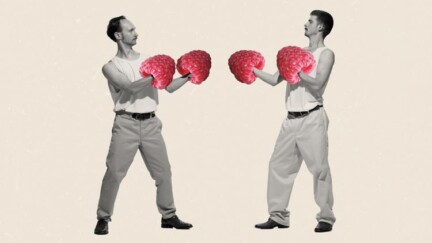Leben
Wie gelingt die Fernbeziehung? Was tun bei seelischem Unwohlsein? Und wie verläuft ein WG-Leben stressfrei? Hier findest du wertvolle Infos, Tipps und Tricks, welche dich in deinem Leben bereichern können.

master1305 – stock.adobe.com
Ernährung: Zeit für das leibliche Wohl
Über die richtige Ernährung ranken sich viele Mythen. Wie du dich ausgewogen ernährst, mit welchem Wissen du zum wahren Weinkenner avancierst und warum es nicht immer Kaffee am Morgen sein musst. Wir liefern dir Tipps rund um das Thema Ernährung.
Freundschaft und Liebe: Wie erfüllende Beziehungen gelingen
Wie geht Flirten? Was tun bei Liebeskummer? Und wie pflegst du deine Freundschaften? Neben dem Hörsaal soll (hoffentlich) auch etwas Platz für romantische und platonische Beziehungen bleiben. Schau dir unsere Tipps rund ums Thema Freundschaft und Liebe an.
Psyche: Auf dem Weg zu mentaler Gesundheit
"Ganz ehrlich zu sich selbst zu sein, ist eine gute Übung", sagte schon Sigmund Freud. Dabei ist es nicht immer einfach, auf sein Inneres zu hören. Erfahre, wie du dein seelisches Gleichgewicht findest, was du bei Mobbing tun kannst und vieles mehr zum Thema Psyche.
Wohnen: Trautes Heim – Glück allein?
Eine bezahlbare Wohnung als Student zu finden, ist schon schwer genug. Doch wie kommst du mit deinen Mitbewohnern klar? Und welche Rechte kannst du als Mieter geltend machen? Wir geben Tipps, wie du dein persönliches Glück im Zuhause findest.

















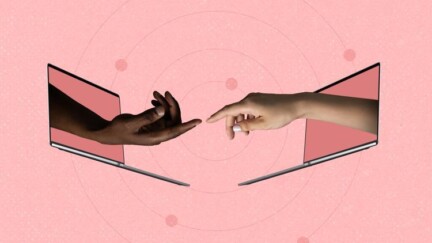

![Ein Paar hält sich an den Händen, die Köpfe sind von einem großen Herz überdeckt [© Lustre – stock.adobe.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Symbolbilder/_card/3225745/Liebe-romantisch-Paar.jpg)





![Eine Frau meditiert auf einer Wolke, ihr Gesicht ist durch eine Sonne ersetzt [© Porechenskaya – stock.adobe.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Symbolbilder/_card/3222489/meditieren-entspannen-beruhigen.jpg)
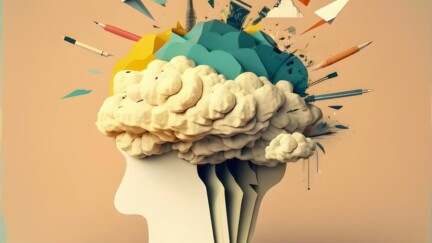




![Skyline einer Stadt mit einer roten Sonne am Himmel [© master1305 – stock.adobe.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Symbolbilder/_card/3221401/Stadt-Haeuser-Immobilien.jpg)

![Eine Hand überreicht der anderen Hand einen Hausschlüssel [© BillionPhotos.com – stock.adobe.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Symbolbilder/_card/3226137/Immobilie-Wohnungssuche-Hausschluessel.jpg)