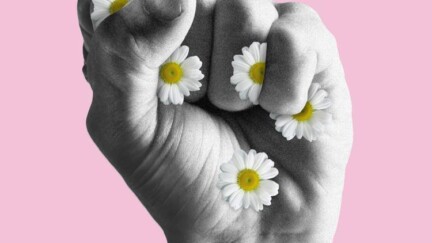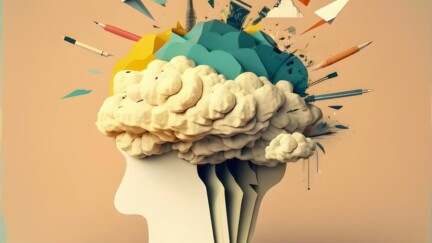Höchstbegabte Psychologin: "Hochintelligente stellen oft eine Herausforderung für das Selbstwertgefühl von anderen dar"
- Lisa Becker

master1305 - stock.adobe.com
Einer von tausend hat einen IQ über 145. Die Psychologin Frauke Niehues ist selbst höchstbegabt und erklärt, wie Superintelligente denken, weshalb nicht wenige beruflich scheitern und warum sie Neid von Normalbegabten verstehen kann.
e‑fellows.net präsentiert: Das Beste aus der F.A.Z.
Lies bei uns ausgewählte Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und von FAZ.NET.
Frau Niehues, mit anderen über die eigene außergewöhnlich hohe Intelligenz zu sprechen, stelle ich mir auch heikel vor.
Das fällt vielen Hoch- und Höchstbegabten nicht leicht, mir auch nicht. Deshalb ist es mir sehr wichtig festzuhalten, dass der IQ nichts über den Wert eines Menschen aussagt. Hoch- und Höchstbegabung sind in meinen Augen eine Form der Neurodiversität: Reize werden schneller, vernetzter und häufig auch intensiver verarbeitet. Dies führt zu Unterschieden in der Wahrnehmung und Strukturierung der Welt und geht auch mit besonderen Bedürfnissen einher.
Welche Bedürfnisse sind das zum Beispiel?
Hochintelligente brauchen ein hohes Maß an intellektuellem Input, um entspannt zu sein. Bleibt dieser aus, entsteht physiologischer Stress. Logische Stimmigkeit hat einen sehr hohen Stellenwert. Hieraus folgt zum Beispiel, dass Traditionen schneller infrage gestellt werden. In Studien wurde nachgewiesen, dass bei Hochintelligenten das Persönlichkeitsmerkmal Offenheit signifikant höher ausgeprägt ist. Ungerechtigkeit ist für viele besonders schwer aushaltbar. Die meisten Hochintelligenten haben sehr feine Sinne, und bei manchen treten Synästhesien auf: Zum Beispiel nimmt man Zahlen als Farben wahr oder hat den Eindruck, Orangensaft schmeckt wie Dreiecke auf der Zunge. Viele Höchstbegabte müssen deshalb aufpassen, nicht reizüberflutet zu werden. All dies kann auch schon bei Hochbegabung, die offiziell bei einem IQ von 130 beginnt, eine Rolle spielen.
Gibt es dann nochmal Unterschiede zu den Höchstbegabten mit einem IQ über 145, zu denen Sie auch gehören?
Bei Höchstbegabten treten diese Merkmale üblicherweise häufiger und ausgeprägter auf. Eine quantitativ höhere Ausprägung kann in eine neue Qualität des Denkens überschlagen. Viele Höchstbegabte erfassen die Welt zum Beispiel intuitiver. Sie sehen eine Matheaufgabe und wissen das Ergebnis einfach, den Weg dahin, was in ihrem Kopf passiert, können sie nicht benennen.
Haben Sie ein Beispiel aus Ihrem Leben?
Ich habe ein Selbstwertmodell entwickelt und werde immer wieder gefragt, wie ich das gemacht habe. Ich habe es plötzlich vor meinem inneren Auge mitsamt Grafik gesehen. Dies noch nicht mal, als ich mich gerade aktiv mit dem Thema beschäftigt habe, sondern in einer Alltagssituation. Es tauchte einfach auf, und ich wusste sofort, jetzt ist es rund.
Welche Besonderheiten findet man außerdem bei hochintelligenten Menschen?
Interessanterweise gibt es auch körperliche Merkmale: Sie sind im Schnitt etwas größer, öfter kurzsichtig, und der Körper ist etwas symmetrischer. Es gibt auch Korrelationen mit Erkrankungen, zum Beispiel mit Allergien. Über 50 Prozent der mathematisch Höchstbegabten haben eine Autoimmunerkrankung. Zudem existiert eine Schnittmenge mit AD(H)S, Autismus und Hochsensibilität. Auch dies erscheint bei Höchstbegabten nochmals öfter beziehungsweise deutlicher ausgeprägt zu sein. Sehr spannend ist auch, dass ich in meiner Praxis eine Häufung von Transgender beobachte. Hinsichtlich Autismus wissen wir, dass es eine Häufung gibt, bei Hochintelligenz ist es meines Wissen noch nicht untersucht. Diese physiologischen Korrelate zeigen, dass Hochintelligenz sich nicht nur auf den Intellekt bezieht. Meiner Ansicht nach sollte es als neurophysiologisches Set betrachtet werden.
Alle über einen Kamm scheren darf man aber sicher nicht.
Auf keinen Fall. Jeder Hochintelligente ist anders. Es gibt viele Merkmale, die mit Hochintelligenz einhergehen können, aber nicht müssen. Deshalb erstelle ich mit jedem ein individuelles Profil.
Sprechen Sie mit anderen Höchstbegabten anders als mit Normalbegabten?
Oft spreche ich schneller mit ihnen. Teilnehmer meiner Seminare bitten mich zuweilen, langsamer zu reden und weniger Informationen in einen bestimmten Zeitraum zu packen. Das hat mit dem visuell-assoziativen Denkstil zu tun. Ich denke weniger linear oder in Schritten – erstens, zweitens, drittens –, sondern netzwerkartig: Eine Idee verknüpft sich in viele Richtungen, und es arbeitet dort. Und dann bin ich zum Beispiel im Museum, und es fällt mir etwas ein und vernetzt sich, und irgendwann ist alles da. Wichtig ist für mich auch, mir ein Thema in der Tiefe zu erarbeiten; das gesamte Netzwerk muss stimmen. Wenn nur ein Steinchen nicht passt, dann habe ich ein sehr großes Störgefühl. Erst wenn jede Verbindung stimmt, werde ich ruhig. Das endet manchmal in zu hohem Perfektionismus.
Dieses assoziative Denken stelle ich mir aber auch schön vor.
Es ist super. Allerdings: Wenn man so stark netzwerkartig denkt, dann gibt es immer noch eine und noch eine Perspektive. Ich kenne viele Höchstbegabte, die wirklich Entscheidungsschwierigkeiten haben, auch im Alltag. In einem komplexen System können Kleinigkeiten einen großen Unterschied machen. Höchstbegabte können deshalb Details kaum ignorieren. Das bringt manche schier um. Dann gibt es auch noch das Problem, diese große Komplexität, das ganze Netzwerk nach außen zu bringen und verständlich zu machen. Man kann Techniken erlernen, mit denen man die Komplexität reduziert, einfach ist das aber nicht. Ich musste mir da einiges mühselig aneignen. Hier hat mir auch mein Beruf als Psychotherapeutin sehr geholfen.
Wie können Sie und andere Höchstbegabte mit durchschnittlich Intelligenten gut sprechen?
Das ist ein häufiges Beratungsthema in meiner Praxis. Damit andere folgen können, muss man in eine Linearität kommen. Man muss lernen, zu priorisieren und das Unwohlsein auszuhalten, das dies hervorruft. Außerdem kann man mit Metaphern arbeiten, sie sind bildhaft und können Komplexes darstellen. Oder Mindmaps verwenden. Wenn man sich nicht verständlich machen kann, ist man nicht in Beziehung und vereinsamt.
Wie kommen Höchstbegabte in ihren Familien zurecht?
Ich habe eine gemischte Familie; ein Kind ist hochbegabt, eins normalbegabt. Sie funktionieren im Alltag unterschiedlich, was manchmal eine Herausforderung ist. Hier sind Werte wichtig: Jeder Mensch ist unterschiedlich, es gibt verschiedene Stärken, keiner ist mehr wert als der andere. Bei uns hat das zum Glück gut geklappt. Ich kenne aber etliche gemischtbegabte Familien, in denen Geschwisterverhältnisse zerbrochen sind.
Was ist der kritische Punkt?
Hochintelligente stellen oft, ohne es zu wollen, eine Herausforderung für das Selbstwertgefühl von anderen Personen dar. Ich hatte schon höchstbegabte Frauen in meiner Praxis, die bei mir einen IQ-Test gemacht haben, ihrem Partner das Ergebnis berichtet haben und daraufhin verlassen worden sind. Einer hat spontan rückgemeldet: "Es tut mir leid, das halte ich nicht aus." Ein weiteres Thema ist Neid.
Können Sie den Neid der anderen nachvollziehen?
Ja, ich habe tatsächlich Verständnis dafür. Neid ist ein überlebenswichtiges Gefühl, es soll sicherstellen, dass man bei der Ressourcenverteilung nicht hinten runterfällt. Wer einen hohen Status hat, bekommt mehr von den knappen Ressourcen. In unserer Gesellschaft öffnet schulischer Erfolg Türen zu Status. Wenn ein Normalbegabter die Intelligenzdifferenz nicht ausgleichen kann, kann er den Status des anderen reduzieren. Möglichkeiten hierfür sind lästern, Informationen vorenthalten und Erfolge verhindern oder ausgrenzen. Dem sind Hoch- und Höchstbegabte oft ausgesetzt. Was sie auch oft spüren, ist, dass andere sich über ihre Misserfolge freuen.
Das ist bestimmt sehr verletzend.
Sehr. Hinzu kommt: Neid wird nicht transparent und offen, sondern "hintenrum" ausgelebt. Weil das Verhalten der anderen oft diffus und nicht greifbar ist, mindert es das Selbstwertgefühl und das Vertrauen in andere Menschen. Dabei geht es den Hochintelligenten gar nicht darum, über den anderen zu stehen, sie haben vor allem ein großes inhaltliches Interesse.
Wie stark müssen sich Hoch- und Höchstbegabte anpassen?
Sie müssen sich sehr oft herunterregulieren mit Blick auf Geschwindigkeit, Komplexität, Ausdrucksweise, Interessen. Und einschätzen, ob sich das Gegenüber angegriffen, bedroht oder verletzt fühlt. Weist man etwa den Chef auf einen logischen Bruch hin, ist unsicher, wie er reagiert. Findet er den Hinweis gut, oder fühlt er sich infrage gestellt?
Anpassen oder sich offen zeigen, was ist der bessere Weg?
Das kommt auf die Situation an. Grundsätzlich befindet sich ein Hochintelligenter oft in einer Lose-lose-Situation: Entweder zeige ich mich nicht und bleibe sozial integriert. Oder ich zeige mich und begebe mich in die Gefahr, ausgestoßen zu werden. Es fällt aber schwer, sich nicht zu zeigen, denn Hochbegabte können zum Beispiel logische Brüche nicht stehen lassen. Viele befassen sich mit existenziellen Sinnfragen; ich kenne Dreijährige, die sich mit dem Nichts beschäftigen. Das kann für andere viel zu viel sein. Kann man sich damit zeigen? Wenn man sich andererseits versteckt, bleibt man zwar sozial integriert, unterfordert sich aber, was auch schlecht ist, denn man braucht viel Anregung und Input, um sich wohlzufühlen. Ein weiterer Teufelskreis, der entsteht: Wenn ich immer nur eine Fassade zeige, weiß ich nie, ob die anderen wirklich mich mögen oder nur meine Fassade.
Tun wir Deutschen uns besonders schwer mit den Hochintelligenten?
Ich bin Mitglied in der internationalen Triple Nine Society für höchstbegabte Menschen; sie hat weltweit rund 2500 Mitglieder. Auf dem letzten Treffen hat sich zum Beispiel ein Franzose darüber gewundert, wie sehr sich manche Deutsche für ihren hohen IQ schämen und ihn verstecken. Das hat, denke ich, viel mit unserer Geschichte zu tun: Im Dritten Reich wurden geistig Behinderte aussortiert und getötet. Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar und wichtig, dass der IQ-Begriff kritisch betrachtet und diskutiert wird. Weiterhin ist auch der Elitebegriff durch unsere Geschichte sehr negativ besetzt.
Der Gesellschaft als Ganzes würde es aber sehr nutzen, wenn die Superintelligenten nicht ausgebremst würden.
Absolut. Es ist wichtig, eine differenzierte Betrachtungsweise zu entwickeln. Der Gesellschaft geht ein sehr hohes Potential verloren. Ich habe junge Leute, vor allem Mädchen, in der Therapie, die Fehler in Klausuren einbauen, damit sie sozial integriert bleiben. Sie wollen nicht die Streberin, der Nerd sein und verstecken sich. Für Höchstbegabte ist die Lage besonders schwierig. Eine Studie zeigt, dass sie seltener Abitur haben als Hochbegabte und seltener die Fachhochschulreife.
Verbessert sich etwas in den Schulen?
Die Nachfrage nach meinen Lehrerfortbildungen stieg über die Jahre. Doch seit Corona fällt die Hochbegabtenförderung durch die zunehmende Überforderung der Schulen und Lehrer wieder mehr hinten runter. Man glaubt, zuvorderst die Kinder, die die Lernziele nicht erreichen, fördern zu müssen. Es ist nicht sinnvoll, die beiden Gruppen gegeneinander auszuspielen. Wir haben gesehen, das Hochintelligenz mit vielen Herausforderungen einhergehen kann. Die Förderung der Hochintelligenten ist wichtig und Teil der Inklusion.
Welche Rolle spielen Klischees?
Eine große. Wenn ich Lehrkräfte bitte, sich ein hochbegabtes Kind vorzustellen, denken die wenigsten an ein Mädchen oder an ein Kind mit Migrationshintergrund. Viele denken hingegen an einen deutschen Jungen mit Verhaltensauffälligkeiten. Da sieht man gleich drei Klischees auf einmal. Viele Hochbegabte sind sozial kompetent, auch Menschen mit Migrationshintergrund sind hochbegabt und Mädchen natürlich auch. Was viele auch nicht wissen: Es gibt etliche Hochbegabte mit Lese-/Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie. Hochbegabung ist nicht gleich Hochleistung, es ist eine Art zu denken beziehungsweise wie das Gehirn funktioniert.
Höchstbegabte sind den anderen intellektuell weit voraus. Wie groß ist der Unterschied?
Ein verbal höchstbegabtes Kind hat im Alter von sieben mindestens das Sprachverständnis eines Sechzehnjährigen. Ein anderes Beispiel: Ich hatte mal ein vierjähriges Kind, das spielte ein paar Minuten mit dem Taschenrechner des Vaters und konnte danach Wurzeln ziehen. Viele lernen sehr früh lesen. Ich kenne mehrere höchstbegabte Kinder, die in der Grundschule schon Zeitungen und Fachbücher lesen, weil es interessant für sie ist. Wichtig ist: Es gibt verschiedene IQ-Profile. Manche haben eine sehr hohe Wahrnehmungsgeschwindigkeit, andere haben eine Spitze im logisch-analytischen Denken, einige sind in allen Bereichen ungefähr gleich.
Sind alle Wunderkinder?
Nein. Selbst Höchstbegabung geht nicht immer mit extremen Fähigkeiten in allen Bereichen einher. Hierfür bin ich ein gutes Beispiel: Ich war in der Schule außergewöhnlich gut in Deutsch und den Geisteswissenschaften. In Mathe war ich gut, aber definitiv kein Genie, und Fremdsprachen muss ich mir aneignen; andere Höchstbegabte lernen mühelos sieben, acht Fremdsprachen. Bei mir erlebe ich oft ein intuitives Erfassen: Ich lese etwas oder sehe eine Matheaufgabe und erkenne, irgendwo steckt ein Fehler, kann aber noch nicht sagen, wo. Und ich denke kreativ. Höchstbegabung zeigt sich im Detail unterschiedlich. Ich erkenne es oft daran, dass ein Mensch jeden kleinen logischen Bruch erkennt oder seine Fragen immer auf den Kern und in die Tiefe zielen.
Hier gibt’s weitere spannende Einblicke
Wie sollten Lehrkräfte auf die hochintelligenten Schüler eingehen?
Es reicht nicht, ihnen einfach mehr Aufgaben zu geben, sie brauchen komplexe Aufgaben, die leicht über ihrem Niveau liegen. Nicht nur weil Unterforderungen und Routinen zu physiologischem Stress führen und bei manchen körperliche Schmerzen hervorrufen, sondern auch weil ihnen die Möglichkeit gegeben werden muss, lernen zu lernen. Sie brauchen Übungsfelder dafür, wie man sich anstrengt, wie man mit anfänglichem Frust, Hilflosigkeit oder Überforderung umgeht und Lernstrategien entwickelt und einsetzt. Dies wirkt sich sehr auf das weitere Leben aus. In meiner Praxis erlebe ich immer wieder Menschen, die haben Abitur gemacht, ohne je dafür gelernt zu haben, manche mit super Noten, andere mit mittleren. Dann kommen sie ins Studium, wo man lernen müsste, doch sie haben keine Strategie dafür. Ich habe hier Höchstbegabte mit 1,0-Abitur, die das Studium nicht geschafft haben. Das hat sie in Identitätskrisen gestürzt.
Können sich hoch- und höchstbegabte Schüler und Studenten auch selbst fordern?
Dafür gibt es einige Möglichkeiten. Wenn man gerade eine Fremdsprache lernt, kann man alles, was der Lehrer oder Dozent sagt, im Kopf simultan in die andere Sprache übersetzen. So erhöht man die Komplexität, bleibt beim behandelten Thema und schweift nicht ab. Viele hören Dokumentationen oder Seminare in doppelter Geschwindigkeit. In der Freizeit kann man sich etwa über den Schachclub, das Lesen von Geschichtsbüchern bis hin zum Austausch mit Fachleuten sehr gut selbst versorgen.
Ist man im Beruf oft genervt, weil die anderen langsamer sind, weniger logisch und tief denken?
Zunächst: 50 Prozent der Höchstbegabten sind selbständig. Und nur einen Beruf zu haben, würde vielen langweilig werden. Manche haben fünf, sechs Berufe. Nach einer Studie hat ein Viertel der Höchstbegabten mehrere Berufe und nur ein Sechszehntel der Hochbegabten. Hilfreich ist, sich einen langfristig fordernden und sich weiterentwickelnden Beruf zu wählen und/oder sich in ein intellektuell geprägtes Umfeld zu begeben. Ein guter Weg kann sein, Mediziner zu werden oder an der Hochschule zu bleiben.
Und in einem Unternehmen?
Das kann funktionieren, wenn das Team Vielfalt und die besonderen Fähigkeiten der Hochintelligenten schätzt. Ihr unkonventionelles, kreatives Denken kann andere aber auch überfordern und anstrengen – wenn sie immer alles infrage stellen und nochmal eine neue Idee haben. Da sollten sie erspüren können, was für die anderen noch okay ist und was zu viel. Ich muss nicht jeden logischen Bruch offenlegen, einen, der relevante Auswirkungen hat, aber schon.
Ist es besser, Führungskraft zu werden?
Nicht jeder Hochintelligente will das, weil man weniger inhaltlich arbeitet. Die Frage ist auch, wie gut man sich in andere hineinversetzen kann. Wer daran scheitert, wird oft als sozial inkompetent wahrgenommen. Ein guter Chef sollte außerdem seine Mitarbeiter nicht überfordern. Als Führungskraft muss man zudem Entscheidungen treffen. Das können manche nicht.
Scheitern auch einige beruflich?
Oh ja. In der Triple Nine Society haben wir Mitglieder in Toppositionen und solche, die Topunternehmen hochgezogen haben. Andere haben hingegen keinen Schulabschluss, sind nicht in der Lage zu arbeiten. Manche können nur einen halben Tag arbeiten, damit sie sich nicht zu vielen Reizen aussetzen. Einer meiner Bekannten arbeitet drei Monate im Jahr, analysiert Daten, verdient gut Geld – und ist in dieser Zeit vollkommen überaktiviert, schläft kaum, bezeichnet es als "die Hölle" für sich. Das restliche Jahr macht er, was er möchte, studiert, liest Bücher, macht Musik, alles in seinem Tempo.
Sie kommen offensichtlich gut zurecht. Wie gelingt Ihnen das?
Ich habe mir mit der Psychologie ein Fach gesucht, mit dem ich ganz viel machen kann. Ich bin im klinischen Bereich tätig, in der Personal- und Organisationsentwicklung, habe verschiedene Therapieausbildungen absolviert, bin Autorin, Herausgeberin und organisiere das Spendenprojekt "MethodenSchatz". Ich leite ein Fortbildungsinstitut und bin in der Lehre tätig, habe mittlerweile ein Portfolio mit 26 Seminaren im Angebot. Ich brauche immer etwas Neues. Andere denken, ich bin leistungsorientiert. Doch das ist es nicht. Es passiert ständig etwas in meinem Kopf, ich muss dauernd Konzepte und Ähnliches entwickeln, nur so kann ich mich entspannen.
Liegen Sie nachts nicht wach und denken nach?
Leider ja - wenn ich mir ein neues Thema vornehme. Mein Mann sagt dann oft liebevoll: Oh weh, jetzt geht das wieder los! Dann liegt hier alles voll mit Büchern und Texten aus allen möglichen Gebieten. Egal wo ich bin, ständig kommen mir Ideen, ständig verknüpft sich noch etwas. Ich kann das nicht steuern, bin dem etwas ausgeliefert, bis es dann gut ist. Es ist eine Lebensaufgabe, die Balance zu finden zwischen angeregt und nicht überfordert sein.
Haben wir zu viel über die Unterschiede zu Normalbegabten gesprochen?
Ich bin dankbar dafür, dass ich die Unterschiede benennen durfte – nicht um Grenzen zu ziehen, sondern um einen differenzierten Blick jenseits gängiger Klischees zu ermöglichen und gegenseitiges Verständnis zu fördern. Denn bei aller Unterschiedlichkeit gilt: Menschen sind sich im Grundsatz sehr ähnlich. Auch bei Hoch- und Höchstbegabten sind es Gefühle und Bedürfnisse, die das Handeln im Kern motivieren. Ebenso wichtig ist: Auch Höchstbegabte machen viele Fehler und verstehen bei Weitem nicht alles. Und es gibt viele Situationen, in denen nicht der Intellekt entscheidend ist, sondern ganz andere Fähigkeiten und Qualitäten gefragt sind.
Alle Rechte vorbehalten. Copyright Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.



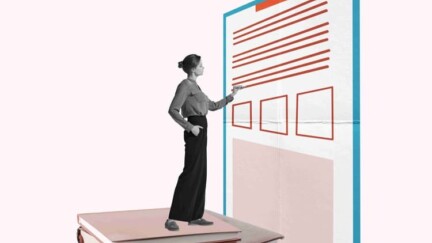
![Eine Frau wird von verschiedenen Geräten aus dem Arbeitsalltag – Block, Laptop, Taschenrechner, Bücher – umkreist [© master1305 – stock.adobe.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Symbolbilder/_card/3220353/Aufgaben-Verantwortung-Multitasking.jpg)