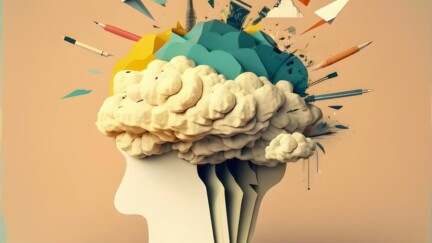Psychologie: Wie Sie sich wieder für die Arbeit motivieren können
- Leonie Weindorf

deagreez – stock.adobe.com
Sie haben keine Lust mehr auf die immer gleiche Arbeit, haben innerlich bereits gekündigt? Die Wissenschaft hat ein paar Hinweise, wie Sie ihre Motivation wieder aktivieren.
e‑fellows.net präsentiert: Das Beste aus der F.A.Z.
Lies bei uns ausgewählte Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und von FAZ.NET.
Gehen Sie gerne zur Arbeit und geben stets Ihr Bestes? Nur etwas über ein Fünftel der Arbeitnehmer in Deutschland beantworten diese Frage klar mit Ja. Der Rest macht Dienst nach Vorschrift. Und die Unlust steigt: Im Gallup Engagement Index 2024 waren es mehr als vier Millionen Arbeitnehmer mehr als im Vorjahr.
Dabei galt für viele von ihnen, als sie frisch in ihren Job gestartet sind, dass sie bei der Arbeit eine Menge Spaß hatten. Doch mit der Zeit ließ die Freude nach. Meetings reihten sich aneinander, Aufgaben wiederholten sich – und für jede erledigte Aufgabe landeten fünf neue auf der Liste. Und irgendwann drängte sich die Frage "Warum mache ich das eigentlich alles?" immer häufiger in ihren Kopf.
Marco Nink, Leiter der Gallup-Studie, sieht deshalb die Vorgesetzten in der Pflicht, dem entgegenzuwirken. "Führungskräfte tun zwar etwas gegen Demotivation, aber nicht genug, um aktiv für Motivation zu sorgen." Dabei haben Arbeitgeber ein wirtschaftliches Interesse an engagierten Mitarbeitern, denn selbst der qualifizierteste Angestellte kann ohne Motivation keine Leistung erbringen. Starren die Mitarbeiter mehrere Stunden am Tag resigniert gegen die Wand, schadet das dem Unternehmen langfristig.
Die Folgen von Demotivation gehen weit über die Wirtschaft hinaus. Menschen in Deutschland verbringen durchschnittlich über 52.000 Stunden ihres Lebens mit Arbeiten – mehr als ein Achtel ihrer Lebenszeit. Wer bereits sonntags ein flaues Gefühl im Magen hat, weil die Woche voller Arbeit bevorsteht, riskiert auf Dauer nicht nur Unzufriedenheit, sondern auch gesundheitliche und psychische Probleme.
Wie bricht man aus dem Trott aus? "Es gibt kein magisches Mittel für mehr Motivation", sagt Kou Murayama, Motivationsforscher und Professor an der Universität Tübingen. In seinen Studien untersucht er, was Menschen antreibt. "Je mehr ich über Motivation lerne, desto komplexer erscheint sie mir", sagt Murayama.
Es gibt eine Vielzahl an Modellen, die die Motivation der Menschen erklären sollen. Eines beschreibt Motivation beispielsweise als Zusammenspiel von drei grundlegenden menschlichen Bedürfnissen: soziale Eingebundenheit, Entscheidungsfreiheit und das Gefühl, kompetent zu sein. Andere Ansätze konzentrieren sich auf die Rolle von Zielen: Sie sollten erreichbar, klar definiert und bedeutsam sein, damit sie motivierend wirken. Ein weiteres Modell sieht Motivation als mathematische Gleichung: Sie ergibt sich aus dem Produkt des Wertes einer Belohnung und der Erwartung, dass das Ziel erreichbar ist, abzüglich des erforderlichen Aufwands, etwa Zeit und Energie.
Welche Theorie stimmt?
Doch welcher dieser Ansätze ist der richtige und hilft, in der Praxis Arbeitsmotivation zu steigern? "Die verschiedenen Modelle haben eine unterschiedliche Herangehensweise und Perspektive auf Arbeitsmotivation und basieren auf unterschiedlichen Menschenbildern – sie haben alle ihre Berechtigung", sagt Arbeits- und Organisationspsychologin Jana Kühnel der Goethe-Universität Frankfurt. Viele der psychologischen Theorien helfen vor allem zu erklären, warum sich die Motivation einer Person in die eine oder andere Richtung entwickelt hat. Verlässliche Vorhersagen sind, ähnlich wie bei wirtschaftlichen Modellen, schwieriger. Trotzdem bieten sie wertvolle Hinweise, welche Maßnahmen hilfreich sein könnten.
Eine zentrale Unterscheidung in der Forschung ist die zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Intrinsische Motivation entsteht aus Freude an der Tätigkeit selbst, während extrinsische Motivation durch äußere Anreize wie Geld oder Anerkennung gefördert wird. Die intrinsische Motivation wird häufig als überlegen und langfristiger geachtet.
Das liegt auch an einem berühmten Experiment, das der Motivationsforscher Edward Deci in den Siebzigerjahren durchgeführt hat: Er ließ Studierende ein scheinbar einfaches, aber kniffliges Puzzle aus kleinen Bausteinen lösen. Eine Gruppe wurde dafür bezahlt, die andere nicht. In einer späteren Phase des Experiments verließ er unter einem Vorwand den Raum, beobachtete die Teilnehmenden allerdings heimlich weiter, um zu erfahren, ob sie freiwillig und ohne Bezahlung weiter an dem Puzzle arbeiten würden. Das Ergebnis: Die zuvor bezahlte Gruppe verlor schnell das Interesse und beschäftigte sich kaum noch mit dem Puzzle, während die unbezahlte Gruppe weiterhin motiviert daran arbeitete.
Geld ist nur eine von mehreren Optionen
Seine Erklärung: Für die bezahlte Gruppe hatte die finanzielle Belohnung den anfänglichen Spaß an der Aufgabe ersetzt – die intrinsische Motivation wurde also verdrängt. Für die Praxis war also die Empfehlung: Arbeitgeber sollten ihre Mitarbeitenden nicht nur durch Gehälter oder Boni motivieren, sondern auch durch Maßnahmen, die das Gefühl von Kompetenz und Zugehörigkeit fördern.
Dass Belohnungen wie Geld zu diesem sogenannten Untergrabungseffekt führen, wurde in zahlreichen Studien bestätigt. Vierzig Jahre nach Decis Experiment untersuchte Murayama den Effekt im Gehirn. Funktionelle Magnetresonanztomographie-Aufnahmen zeigten: Eine interessante Aufgabe aktivierte das Striatum und den präfrontalen Cortex – zwei Hirnregionen für Motivation und Planung. Diese Aktivität nahm zu, wenn Teilnehmende Geld für die Aufgabe erhielten. Doch in einer späteren Phase, in der sie freiwillig weitermachen konnten, blieb die Aktivität nur bei unbezahlten Personen konstant, während sie bei den bezahlten stark abfiel. Murayama erklärt das damit, dass das Gehirn sich an die Belohnung gewöhnt und ohne sie anders auf die Aufgabe reagiert.
Doch neuere neurowissenschaftliche Erkenntnisse stellen die strikte Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation zunehmend infrage. Obwohl die psychologischen Prozesse unterschiedlich sein mögen, werden beide Formen der Motivation letztlich in denselben Hirnarealen verarbeitet. Dabei spielt das Belohnungssystem eine zentrale Rolle: Dopamin, oft stark vereinfacht als "Glückshormon" bezeichnet, wird unter anderem ausgeschüttet, wenn wir ein Ziel anstreben oder erwarten, eine Belohnung zu erhalten. Es steigert dabei unsere Aufmerksamkeit und Energie. Es agiert wie eine Art "Rechner", der die subjektive Bedeutung und den Wert einer Situation oder Handlung analysiert. Es wird vermutet, dass dies nicht nur bei extrinsischer Motivation, also bei Belohnungen von außen, sondern auch bei intrinsischer Motivation geschieht.
Der Schlüssel zur intrinsischen Motivation
Es gibt offenbar nicht nur die zwei Extreme von intrinsischer und extrinsischer Motivation. Stattdessen bewegen wir uns meist auf einem Kontinuum zwischen diesen Polen, betont die Frankfurter Psychologin Kühnel.
Durch diese neue Betrachtungsweise ergeben sich neue Ideen für die Praxis. "Manche Forscher meinen, man sollte extrinsische Belohnungen ganz weglassen und nur auf intrinsische Motivation setzen", erklärt Murayama, der früher selbst dieser Ansicht war. Heute vermutet er, extrinsische Anreize könnten besonders dann helfen, wenn die intrinsische Motivation noch nicht vorhanden ist. Denn: Ist keine intrinsische Motivation da, kann sie zum einen nicht untergraben werden. Zudem wird man eine Aufgabe, für die man nicht motiviert ist, meist gar nicht beginnen. Äußere Belohnungen können also eine Starthilfe sein.
In diesem Ansatz bezieht sich Murayama zunächst auf den Wissenserwerb: Zu Anfang wissen wir wenig über ein Thema oder eine neue Aufgabe. Je mehr wir uns in die neue Aufgabe einarbeiten, desto mehr Fragen ergeben sich. Das produziert neue Motivation, sich weiteres Wissen anzueignen, was dann wiederum zu neuen Fragen führt. Es entsteht ein sich selbst verstärkender Prozess, der aber nur funktionieren kann, wenn er einmal gestartet wurde. Das Modell lässt sich auf alle möglichen Bereiche anwenden, meint Murayama.
Ein Beispiel dafür ist der Sport: Wer anfängt zu trainieren, muss oft mit sich kämpfen. Belohnungen – etwa ein leckeres Essen nach dem Training – können helfen, bis der Körper selbst entsprechende Hormone ausschüttet und die Bewegung als lohnend empfindet.
Auch das soziale Umfeld funktioniert als motivationale Starthilfe: Wir beginnen ein neues Hobby oder probieren eine neue Tätigkeit aus, weil Freunde oder Kollegen uns dazu anregen. Ein gutes Verhältnis zu Kollegen kann uns inspirieren, neue Lösungswege auszuprobieren. Gemeinsame Ziele und ein gutes Miteinander fördern außerdem das Gefühl von Zugehörigkeit, das Menschen antreibt.
Doch wie kann man intrinsische Motivation langfristig unterstützen und gewährleisten, dass die Freude an der Arbeit nicht mit der Zeit vergeht? Pauschal beantworten lässt sich diese Frage nicht. Die Wissenschaft hat aber wichtige Rahmenbedingungen erkannt: Autonomie, Sinnhaftigkeit, Feedback und Abwechslung.
So motiviert es Mitarbeiter, wenn sie Entscheidungen selbst treffen können. Das müssen nicht einmal große Entscheidungen sein – selbst kleine Freiheiten, wie die Reihenfolge von Aufgaben selbst festzulegen, steigern die Motivation. In einer Studie von Murayama versuchten Teilnehmende, eine spielerische Aufgabe zu lösen: Sie sollten eine digitale Stoppuhr bei genau fünf Sekunden anhalten. Teilnehmer durften dabei teilweise aussuchen, wie die Stoppuhr aussah. Das Ergebnis: Die selbstbestimmte Wahl steigerte die Leistung bei der Stoppuhraufgabe, obwohl die Auswahl für das Bewältigen der Aufgabe völlig irrelevant war. Offenbar reagiert das Gehirn bei Entscheidungsfreiheit anders auf Misserfolge.
Noch wichtiger ist es jedoch, sich den Sinn einer Aufgabe zu verdeutlichen. "Wenn ich verstehe, warum eine Aufgabe wichtig ist, fühle ich mich freier in meinen Entscheidungen – auch wenn ich die Aufgabe vielleicht nicht mag", erklärt Murayama. Hier hilft es, die Ziele einer Aufgabe mit den eigenen Werten zu verknüpfen. Hat man beispielsweise das Gefühl, man ertrage es nicht mehr, weitere E-Mails zu bearbeiten oder an Meetings teilzunehmen, sollte man sich überlegen, wie man diese Aufgaben für sich selbst anders formulieren kann. Zum Beispiel mit dem Ziel, einen Urlaub zu finanzieren oder die eigene Familie zu versorgen.
Herausforderungen sollten weder zu groß noch zu klein sein, denn beide Extreme wirken demotivierend. Auch Abwechslung und regelmäßiges Feedback spielen eine wichtige Rolle. Rückmeldungen helfen, Fortschritte sichtbar zu machen, was die Motivation stärkt.
Es gibt also eine ganze Reihe Stellschrauben der Motivation. Als Arbeitgeber ist es in der Regel nicht möglich, bei jedem Mitarbeiter individuell und situationell zu schauen, welche dieser Stellschrauben gerade neu justiert werden müssen. Deshalb sollten möglichst viele dieser Aspekte abgedeckt werden, um alle Mitarbeitenden zu erreichen.
Will man sich selbst oder einen einzelnen Kollegen motivieren, ist es sinnvoll, einmal zu reflektieren, wo man sich auf dem Kontinuum von extrinsischer zu intrinsischer Motivation befindet. Braucht man noch eine extrinsische Starthilfe, oder sollte man lieber seine bereits existierende intrinsische Motivation schützen und fördern? Als Nächstes kann man ermitteln, ob es einem eher an Entscheidungsfreiheit mangelt oder die Ziele nicht erreichbar erscheinen.
Und auch etwas anderes kann helfen: In einer Studie Murayamas lösten Teilnehmende eine monotone Aufgabe und schätzten ihre Motivation dabei im Vorfeld als niedrig ein. Doch während der Aufgabe waren sie viel aktiver, als sie selbst erwartet hatten – außer wenn sie dafür bezahlt wurden. Das bedeutet: "Menschen neigen dazu, ihre intrinsische Motivation zu unterschätzen", erklärt Murayama. "Wir halten eine Aufgabe für langweilig, obwohl wir eigentlich Freude daran haben können." Man kann sich also im Job ruhig mehr Begeisterungsfähigkeit zutrauen und sollte diese auch zulassen.
Alle Rechte vorbehalten. Copyright Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.





![Eine Frau meditiert auf einer Wolke, ihr Gesicht ist durch eine Sonne ersetzt [© Porechenskaya – stock.adobe.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Symbolbilder/_card/3222489/meditieren-entspannen-beruhigen.jpg)