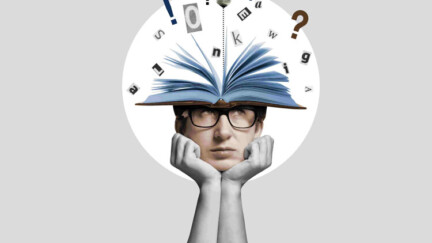Hirnforschung: Endlich so arbeiten, wie der Kopf es braucht
- Marie Rövekamp

svetazi – stock.adobe.com
Viele Menschen sabotieren sich selbst, ignorieren ihr Leistungshoch, arbeiten ineffizient. Zehn Erkenntnisse der Hirnforschung, mit denen man fünfmal produktiver wird.

e‑fellows.net präsentiert: Das Beste aus ZEIT Online
Lies bei uns ausgewählte Artikel von ZEIT Online, Deutschlands führendem Portal für anspruchsvollen Online-Journalismus.
Niemand schadet sich mit so viel Hingabe wie der Mensch. Er bewegt sich zu wenig, lebt in zu lauten Städten, trinkt Bier und verschmutzt die Luft, die er atmet. Obwohl er weiß, wie schlecht das alles für ihn ist, tut er es trotzdem. Auch im Job sabotiert sich der Mensch selbst: Er stört sich und andere, verschwendet Zeit für Unwichtiges, kommt nicht voran. Für den Kopf ist der Büroalltag oft so passend wie ein vereister Winterboden für einen Läufer.
Friederike Fabritius ist studierte Neurowissenschaftlerin, Autorin und hat schon Führungskräfte von Google, SAP und BMW darin geschult, wie gehirngerechtes Arbeiten funktioniert. "Man sollte mit dem Gehirn arbeiten und nicht dagegen", sagt sie. Klingt ganz einfach, wird aber selten gemacht! "Dabei könnten Mitarbeiter fünfmal produktiver sein, wenn sie Erkenntnisse aus der Hirnforschung nutzen", meint Fabritius. Gegen blockierende Gewohnheiten empfehlen sie und andere Experten die folgenden Strategien.
To-do-Listen schreiben
Das Gehirn profitiert sehr von To-do-Listen. "Wenn Menschen sich Aufgaben notieren, müssen sie die nämlich nicht mehr mental mit sich herumtragen", sagt Volker Busch. Der Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie forscht an der Universität Regensburg, schrieb zuletzt das Buch Kopf hoch! und hält ebenfalls Vorträge darüber, wie das Gehirn funktioniert. Er findet es sinnvoll, den Arbeitstag morgens kurz und klar zu strukturieren. Seine Empfehlung: "Nicht zuerst Apps öffnen und Nachrichten lesen, sondern sich drei Punkte mit der höchsten Priorität für den aktuellen Tag aufschreiben – am besten in den Notizblock und nicht ins Smartphone." Eine Alternative: den Mini-Plan schon am Abend zuvor machen.
Bei Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, gilt: In der ersten Stunde nach dem Aufwachen schaut er auf keinen Bildschirm, auch nicht auf den seines Smartphones. Er erzählte schon öfters, dass er stattdessen mit seiner Familie frühstücke, sich mental auf den Tag vorbereite, aber entspannt. Mit dieser langsamen, digitalfreien Morgenroutine könne er besser arbeiten. Wahrscheinlich weiß auch Bezos, wovor Volker Busch warnt: Das ständige Starren aufs Handy kann schädlich sein. Schon die physische Präsenz des Geräts lenkt einen ab. Wer seine tägliche Bildschirmzeit hingegen um eine Stunde reduziert, ist motivierter und zufriedener – das zeigt zumindest eine Studie der Ruhr-Universität Bochum.
Fast jeder von uns kann 30 Prozent seiner Aufgaben weglassen.
Das Gehirn profitiert auch davon, eine Not-To-do-Liste zu führen. Volker Busch sagt, man sollte sich immer mal wieder die Fragen stellen: Worauf kann ich heute verzichten? Welche Aufgabe lasse ich weg? Radikale Priorisierung also! "Fast jeder von uns kann 30 Prozent seiner Aufgaben weglassen", sagt er. Zum Beispiel das tägliche Aufräumen des digitalen Desktops, was nicht zur Produktivität beiträgt, sondern nur der eigenen Ordnungsliebe dient. Solche Tätigkeiten reichten einmal in der Woche – dann seien sie erst mal erledigt.
Den Vormittag nutzen
Ins Büro kommen und alle Benachrichtigungen ausschalten. Erst mal Ruhe! Für Volker Busch gibt es wenig, was die Menschen heutzutage so sehr bräuchten. Wie oft schon jemand vor ihm klagte, er hätte zwar den ganzen Tag etwas getan, aber nichts Wesentliches geschafft. "Ich rate Unternehmen zu einem stillen Korridor, wo zum Beispiel zwischen neun und elf Uhr nicht kommuniziert wird. Außer in Notfällen", sagt Busch. Jeder könne in der Zeit das tun, was am wichtigsten für seine Arbeit ist. Ohne dass jemand an der Tür klopft. Nur eine Frage, nur ganz kurz.
Warum Fokus-Stunden ausgerechnet am Morgen sinnvoll seien? Wegen des menschlichen Biorhythmus, erklärt er. Die Verteilung der Chronotypen – also ob jemand eine Lerche (Frühaufsteher), Eule (Spätaufsteher) oder ein Mischtyp ist – wurde schon in mehreren Studien untersucht. Sogenannte Lerchen sind am frühen Morgen besonders produktiv und ab 17 Uhr kaum noch; Eulen können mittags und abends gut arbeiten und sind vormittags wie vernebelt. Etwa 60 Prozent der Bevölkerung zählen jedoch zu den Mischtypen. Sie wachen zwischen 7 und 9 Uhr auf, haben vormittags ihr Leistungshoch, ein Tief am Mittag und noch einmal eine gute Phase am Nachmittag, wenn auch nicht mehr ganz so ausgeprägt. Allerdings: Der Tag beginnt für viele Menschen mit Besprechungen und dem Beantworten von Nachrichten. Ausgerechnet in ihrer produktivsten Zeit.
Bill Gates ging früher noch einen Schritt weiter. Zweimal im Jahr zog er sich allein in eine Hütte im US-Bundesstaat Washington zurück. Niemand durfte ihn besuchen. Diese Think Weeks seien sehr wichtig für den Microsoft-Erfolg gewesen. Volker Busch vergleicht den Vorteil störungsfreier Zeiten mit einem Glas Wasser, in das Sand geschüttet wird. Rührt man alles mit einem Löffel um, wird die Flüssigkeit unklar und dreckig. Lasse man das Glas Wasser aber ein paar Minuten nur stehen, sinke der Sand auf den Grund. Busch sagt: "Das passiert bei Stille. Es setzt sich mal alles im Kopf – und wir denken wieder klarer."
Seine Stresskurve kennen
Der eine Mitarbeiter braucht Stress, um gut zu arbeiten. Den anderen lähmt er bloß. Das beschreibt zum Beispiel die Yerkes-Dodson-Kurve – 1908 von den Psychologen Robert Yerkes und John Dodson entwickelt. Sie gleicht einem umgekehrten U und soll einen Zusammenhang zwischen innerer Erregung und Leistungsfähigkeit darstellen. Auf der horizontalen Achse wird gemessen, wie angespannt man ist, auf der vertikalen Achse die Produktivität. Die Spitze der Kurve sei der Punkt, an dem jemand seine beste Leistung erbringen kann.
Jeder sollte in einer Umgebung arbeiten, in der sie oder er natürlich erfolgreich sein kann.
Friederike Fabritius meint: Jeder Mitarbeiter sollte wissen, wie sein persönliches Diagramm aussieht. Erreicht jemand sein Optimum bei wenig Druck oder drängelnder Deadline? Um sein eigenes Muster zu erkennen, könnte jemand eine Woche lang Protokoll über sämtliche Aufgaben und Aktivitäten führen und notieren, ob sie oder er sich dabei langweilt, überlastet fühlt oder nichts von beidem spürt. Eine Alternative zur Liste: Den Wecker so einstellen, dass er alle 90 Minuten piept und kurz die gegenwärtige Stimmung mit einem Symbol festhalten.
Wer vom Gequassel des Großraumbüros überstimuliert ist, könnte mit seiner Chefin mehr ruhige Homeoffice-Tage vereinbaren. Ist die Arbeit zu eintönig geworden, kann intern vielleicht der Job getauscht werden. "Jeder sollte in einer Umgebung arbeiten, in der sie oder er natürlich erfolgreich sein kann", rät Fabritius. "Viele versuchen das aber gar nicht erst, sondern meditieren stattdessen."
Auf Pausen achten
Der Schlafforscher Nathaniel Kleitman entdeckte in den 1950er-Jahren, dass der menschliche Schlaf in etwa 90-minütige Zyklen unterteilt ist, bei denen sich verschiedene Phasen – darunter REM- und Tiefschlaf – abwechseln. Dieses Muster übertrug er auf den Wachzustand und formulierte den sogenannten Basic Rest-Activity Cycle, wonach sich tagsüber Leistungs- mit Erholungsphasen im gleichen Takt abwechseln würden. Neuere Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass unser Körper und Geist in individuelleren Rhythmen arbeiten. Aber an einer Erkenntnis hat sich nichts geändert: Das Gehirn braucht Pausen. In Deutschland sind sie nach sechs Stunden Arbeit Gesetz.
Zwischendurch mal aufstehen, ein Glas Wasser trinken, die Schultern kreisen oder einfach mal nichts tun – auch solche Mikropausen steigern nicht nur die Produktivität, sondern verbessern auch die psychische Gesundheit. Wer regelmäßig innehält, reduziert Stress, Erschöpfung – und damit auch das Risiko, ein Burn-out zu bekommen. Im Team können sogenannte Pausenverträge ebenfalls sinnvoll sein, zum Beispiel mit einer mittäglichen Auszeit ohne Bildschirm oder einem kurzen, gemeinsamen Spaziergang.
In Meetings schweigen
In Besprechungen wird gerne schnell und viel geredet. Manchmal von den immer gleichen Personen. Ein Unternehmen, das Fabritius einmal beraten hat, wollte diesen Mechanismus brechen und stellte folgende Regel auf: Die in Stille verbrachte Zeit in Konferenzen sollte mindestens genauso lang sein wie die Zeit, in der gesprochen wird. Auf einen Diskussionsbeitrag von zwei Minuten folgte eine ebenso lange Pause, damit alle das Gehörte kurz verarbeiten können – und dann zur Diskussion bereit sind.
In vielen Meetings würden Mitarbeiter gar nicht richtig zuhören, weil sie im Kopf schon die eigene Antwort vorformulieren. Doch durch die Stillephasen wären die Frauen und Männer in den Runden konzentrierter gewesen, hätten weniger geredet, nur um zu reden, schreibt Fabritius in ihrem Buch Neurohacks. Und all jene, die einen Moment zum Überlegen brauchen, hätten ihn bekommen. Mit besseren Ideen als Resultat.
Etablierter als diese Idee ist in Unternehmen die "Minute zum
Ankommen". Mit dieser Methode beginnen manche Meetings bei Start-ups
oder auch Großunternehmen wie SAP und Otto damit, dass die Zeit anfangs
für eine Minute gestoppt wird. Alle schließen die Augen, kommen zur
Ruhe, verscheuchen ihre Gedanken. Sowohl an das nervige Gespräch zehn
Minuten vorher als auch an die vielen, vielen Erledigungen im Anschluss.
Fokus! Das Gehirn soll nur an das denken, was in der nächsten Stunde
geschieht.
Disziplin lernen
Volker Busch warnt außerdem vor Multitasking – beziehungsweise dem Versuch. In Wahrheit könnte niemand zwei Dinge parallel machen. Stattdessen springe das Gehirn beim sogenannten Task-Switching sehr schnell zwischen zwei Aufgaben hin und her, was nach Erkenntnissen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zu einer höheren kognitiven Belastung führt – und so Fehler wahrscheinlicher macht.
Auch Unterbrechungen passieren bei der Arbeit ständig, obwohl sie zu nichts nütze sind. Der Thinktank NWI forscht zur Arbeit im digitalen Zeitalter und hat 2022 ausgerechnet, dass drei volle Arbeitstage im Monat dadurch verloren gehen. Für seine Analyse (PDF), die der Neurowissenschaftler Volker Busch wissenschaftlich begleitet hat, wurden 637 Angestellte aus 25 Unternehmen befragt. Ein Ergebnis: Alle vier Minuten wurden sie bei ihrer Tätigkeit im Schnitt gestört – doch nicht immer waren andere schuld. Viele checkten ohne Not sechsmal in der Stunde ihr E-Mail-Postfach, statt ihre Aufgabe zu vollenden.
Volker Busch empfiehlt Beschäftigten und Vorgesetzten mehr Disziplin: "Seit der Pandemie werden Videokonferenzen und Chatprogramme inflationär genutzt." Das seien zwar praktische, technische Möglichkeiten, aber Angestellte würden an manchen Tagen nur noch sekundenschnell verfasste Nachrichten beantworten und ihre wirkliche kreative Arbeit bleibe liegen. Chefinnen und Chefs sollten auf Micromanagement verzichten und nur das Allernötigste zu ein paar festen Zeitpunkten am Tag mitteilen. Nicht alles und immer. Wer hält schon eine Maschine ständig an?
Ein- und lange ausatmen
Menschen atmen zwar ununterbrochen, aber häufig falsch. Das belegte zum Beispiel eine US-amerikanische Studie der University of Evansville, wonach 60 bis 80 Prozent der Menschen zu schnell und zu flach atmen. Sie holen nicht tief genug Luft, füllen nur den oberen Brustkorb statt des Bauchs und zählen 14 bis 18 Atemzüge in der Minute. Idealerweise sollten es laut den Studienautoren jedoch nur zehn sein, wenn sie bloß auf dem Bürostuhl sitzen und nicht etwa Fahrrad fahren. Was die Ursache für das falsche Atmen sei? Stress.
Wenn ich es schaffte, meinen Körper in einen entspannteren, zufriedenen Zustand zu versetzen, macht mein Gehirn mit.
Vor allem langes Ausatmen wirkt beruhigend. Wie das gelingen kann, ohne dass es den Kollegen auffällt? Zum Beispiel mit der 4-2-6-Atemübung. Dabei atmet man still durch die Nase ein und zählt innerlich langsam bis vier, hält den Atem für zwei Sekunden – und atmet schließlich langsam und leise durch die Nase aus, während man bis sechs zählt. Das Herz schlägt dadurch laut Studien langsamer, der Blutdruck wird gesenkt und der parasympathische Teil des Nervensystems aktiviert. Sogar mitten im Chaos.
"Es gibt ganz viele Verbindungen zwischen Körper und Gehirn", sagt Friederike Fabritius. "Wenn ich es schaffte, meinen Körper in einen entspannteren, zufriedenen Zustand zu versetzen, macht mein Gehirn mit."
Kleine Schritte gehen
In Unternehmen werden ständig Fehler gemacht. Einer ist es, zu schnell zu viel zu wollen. "Dabei macht eine drastische Veränderung dem Gehirn Angst", sagt Fabritius. Bei neuen Gewohnheiten müsste es intensiv arbeiten, um die unbekannten Abläufe zu etablieren. Was anstrengend ist. "Besser ist es, bei der Arbeit viele kleine Schritte zu machen", sagt sie. Auch Führungskräfte würden ihren Mitarbeitern oft überfordernde Aufgaben geben, was auf beiden Seiten zu Enttäuschungen führe.
Sie empfiehlt, große Ziele auf kleine Ziele herunterzubrechen. Wenn ein Pflegerinnen-Team ein neues digitales Dokumentationssystem nutzen soll, könnte sich die Leitung dazu entschließen, nicht alles auf einmal umzustellen, sondern Woche für Woche einzelne Module – zuerst die Medikationspläne, danach die Behandlungsdokumentation.
Auf diesem Grundsatz basiert beispielsweise die Kaizen-Methode ("Kai" bedeutet Veränderung und "zen" gut), die durch den japanischen Ingenieur und Berater Masaaki Imai weltweit populär wurde. In seinem Bestseller beschrieb er schon 1986, wie kontinuierliche, kleine Verbesserungen statt gigantischer Reformen den Produktionsprozess optimieren würden – und schließlich die gesamte Unternehmenskultur. Unter anderem haben Toyota, Honda und Nestlé diese Methode bei sich eingeführt.
Für Dopaminschübe sorgen
Möchte ein Chef herausragende Leistungen, sollte er dafür sorgen, dass in den Köpfen seiner Angestellten so oft wie möglich Dopamin ausgeschüttet wird. Der Neurotransmitter erzeugt ein Belohnungsempfinden. Ein Hochgefühl. Doch wie lässt sich diese biochemische Reaktion auslösen? Bei der Arbeit, indem Chefs Stärken stärken.
Friederike Fabritius arbeitete vor ihrer Selbstständigkeit am Max-Planck-Institut für Hirnforschung und bei der Unternehmensberatung McKinsey. Schon oft habe sie gesehen, dass Beschäftigte alles können und machen sollten. Der strukturierte Projektmanager, der Pläne liebt, soll sich beispielsweise mehr in kreativen Brainstorming-Runden einbringen. Spontan und intuitiv. Oder eine Erzieherin wird dazu gedrängt, Entwicklungsgespräche mit Eltern zu führen – obwohl ihr das nicht liegt und die Kollegin große Freude daran hat. Sie sollen trotzdem die gleichen Aufgaben erfüllen. Aus Prinzip.
Sehr viele gute Ideen entstehen, wenn man gerade nicht aktiv darüber nachdenkt.
Unsinnig findet das Fabritius. Eine Chefin sollte wissen, wer vorsichtig oder erfinderisch, eher ein Macher oder Mahner ist. Würden Vorgesetzte mehr Rücksicht auf die Persönlichkeit nehmen und Aufgaben so weit wie möglich daran anpassen, wären Angestellte nicht nur zufriedener, sondern auch besser in ihrem Job. "Das heißt nicht, dass man Schwächen völlig ignorieren sollte", sagt sie. Aber man solle einen Mitarbeiter auch nicht in etwas verwandeln wollen, das er nicht ist.
In einem durchdacht aufgestellten Team würden Menschen arbeiten, die alle eine oder mehrere ausgezeichnete Fähigkeiten haben. Darauf sollten sich die Vorgesetzten konzentrieren. Wer bei sich Fortschritte erkennt, Erfolg hat, für das gelobt wird, was ihm wichtig ist, und Freude hat, aktiviere das Belohnungssystem im Gehirn. Und Dopamin beeinflusst nicht nur die Stimmung. Es wirkt auch daran mit, wie gut sich Menschen konzentrieren können – und wie leistungsstark sie sind.
Dem Unterbewusstsein zuhören
Das Gehirn nimmt weit mehr Informationen auf, als einem bewusst ist. Für Friederike Fabritius steht deswegen fest: Menschen sollten ihrem Unterbewusstsein mehr zuhören – allerdings nicht uneingeschränkt. Dem sprichwörtlichen Bauchgefühl sollte man nur dann folgen, wenn man bei einer großen Frage oder Aufgabe gut Bescheid weiß. "Ist jemand Experte auf seinem Gebiet, ist sein erstes, intuitives Bauchgefühl meistens die richtige Antwort", sagt Fabritius. Langes Grübeln wäre dann nur hinderlich.
Manchmal verbringe der Mensch Stunden, sogar Tage damit, ein Problem zu analysieren. Doch es könne hilfreich sein, mental mal loszulassen. "Sehr viele gute Ideen entstehen, wenn man gerade nicht aktiv darüber nachdenkt", sagt Fabritius. Nach einem Mittagsschlaf. Beim Laufen. Unter der Dusche. Paradox ist nur: In vielen Berufen fehlt bei all dem Beschäftigtsein die Zeit für genau solche Momente, in denen sich Gedanken zusammenfügen können und grandiose Einfälle entstehen.
© ZEIT ONLINE (Zur Original-Version des Artikels)




![Eine Frau wird von verschiedenen Geräten aus dem Arbeitsalltag – Block, Laptop, Taschenrechner, Bücher – umkreist [© master1305 – stock.adobe.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Symbolbilder/_card/3220353/Aufgaben-Verantwortung-Multitasking.jpg)


![Eine Frau meditiert auf einer Wolke, ihr Gesicht ist durch eine Sonne ersetzt [© Porechenskaya – stock.adobe.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Symbolbilder/_card/3222489/meditieren-entspannen-beruhigen.jpg)