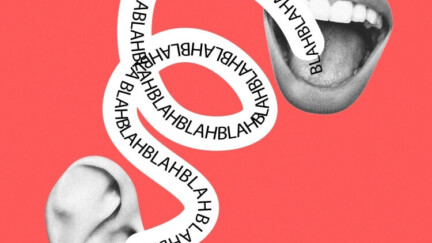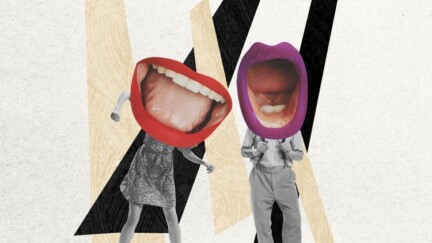Schlagfertigkeit: Wie ich lernte, endlich schlagfertig zu sein
- Torben Becker

master1305 – stock.adobe.com
Oft wird man im Job überrumpelt und schweigt. Wer diskutieren und kontern kann, kommt im Beruf allerdings weiter. Deswegen wollte unser Autor genau das können.

e‑fellows.net präsentiert: Das Beste aus ZEIT Online
Lies bei uns ausgewählte Artikel von ZEIT Online, Deutschlands führendem Portal für anspruchsvollen Online-Journalismus.
Es gibt einen Wunsch, den wahrscheinlich die meisten Menschen haben: Wir wollen uns nicht klein fühlen. Doch oft taucht in unseren Köpfen die Frage auf: "Warum habe ich mir das gefallen lassen?" Oder: "Warum kriege ich den Mund nicht auf?" Zweifel in Großbuchstaben. Man ärgert sich und möchte schlagfertiger für sich eintreten.
Nicht selten passiert das im Arbeitsalltag: wenn uns der Kollege Arbeit überhäuft ("Das schaffst du doch"), wenn die Chefin zum achten Mal die Gehaltserhöhung ausschlägt ("Leider ist das gerade nicht drin") oder wenn ein spitzer Kommentar während der Präsentation die Worte wie Angelhaken im Hals stecken lässt.
Das ist ungefähr auch mein Gefühl, als ich höre: "Ich rufe Torben, den ersten freien Redner, ans Pult."
Ist Schlagfertigkeit angeboren oder kann man sie lernen?
In der Eckkneipe En Passant in Berlin-Prenzlauer Berg sitzen rund 40 Menschen Schulter an Schulter auf Bänken und Stühlen. Es ist gemütlich. Rissige Sitzpolster sind mit Klebeband ausgebessert, die Aprilsonne sinkt draußen über die Häuser. Jede Woche trifft sich hier der Debattierklub Streitkultur. Auf dem Tisch des Diskussionsleiters steht eine Messingglocke mit langem Holzstiel und ein Bier, in seiner Hand ruht ein Richterhammer. Die Debatte läuft, seit einer Stunde streiten die Redner – bisher ausschließlich Männer, dazu später mehr – über die Frage: Soll das Verbreiten von Fake-News strafbar sein?
Ich habe mich freiwillig für einen Redebeitrag gemeldet. Lampenfieber pocht in meinem Kopf auf dem Weg zum Pult. Im Sturm dieser Kneipendebatte will ich überprüfen, wie schlagfertig ich bin.
Wie extrem die Verlegenheit sein kann, wenn einem die Worte fehlen, erlebte die Welt Ende Februar, als JD Vance und Donald Trump Selenskyj im Weißen Haus demütigten. Trump fiel ihm ins Wort, nannte ihn "respektlos". Vance polterte brüskiert, ob Selenskyj jemals "danke" gesagt habe. Das war keine Diplomatie, das war ein Angriff. Warum kann man sogar Staatsoberhäupter aus dem Konzept bringen? Ist Schlagfertigkeit angeboren oder kann man sie lernen?
Das passende Argument hilft nicht nur in der Debatte, sondern auch im Alltag: im Job, in der Beziehung oder in Freundschaften.
Zwei Stunden bevor ich mir einen Weg durch die Stuhlreihen bahne, bin ich mit Balderich Benkenstein in der Kneipe verabredet, dem Vereinsvorsitzenden. Benkenstein legt seinen Trenchcoat ab, darunter trägt er ein Leinenhemd mit hochgekrempelten Ärmeln. Obwohl erst 33 Jahre alt, zählt er zu den Veteranen des Vereins. Seit zehn Jahren ist er dabei. Als Austauschstudent in Großbritannien verfolgte er die leidenschaftlichen Parlamentsdebatten und wollte wie die Abgeordneten im stärksten Gegenwind cool und redlich bleiben.
Über die Jahre lernte er, mit Schwung und Gestik zu sprechen. Was ihm als Rechtsanwalt für Vergaberecht sicherlich zugutekommt. "Mittlerweile ist mir wenig peinlich", sagt er. Ich bewundere ihn dafür, dass der Satz nicht breitbeinig oder arrogant klingt. Man ahnt, dass er gelernt hat, auf seine Fähigkeiten als Redner zu vertrauen. "Das passende Argument hilft nicht nur in der Debatte, sondern auch im Alltag: im Job, in der Beziehung oder in Freundschaften", sagt er. Während wir sprechen, füllt sich der Raum mit dreizehn Männern und Frauen. Wie ich sind sie zum ersten Mal hier. Für uns Neulinge veranstaltet der Verein einen Einführungsabend, damit wir nicht eingeschüchtert von der Leidenschaft der Debatte gleich wieder abhauen.
Menschen, die mich kennen, sagen, ich sei nicht auf den Mund gefallen. Ich reiße Witze, würze Diskussionen mit provokanten Argumenten und scheue keinen Streit. Manchmal bleiben aber auch mir Worte im Hals stecken, dann werde ich rot und ärgere mich anschließend über meine Sprachlosigkeit. Es gibt kaum etwas Schlimmeres als eine verspätete Replik, wenn einem das perfekte Gegenargument erst zu Hause einfällt. Weil mir kein passender Konter einfiel, ließ ich mich schon überreden, im Urlaub zu arbeiten oder unbezahlte Aufgaben zu übernehmen ("Komm schon, ist für eine gute Sache"), oder ich verstummte in der Konferenz, wenn ich bloßgestellt wurde ("So wie Torben würde ich es auf keinen Fall machen").
Es gibt Regeln für Sprechzeiten, Wortwechsel, Zwischenfragen
Ein Vorstandskollege von Benkenstein sagt zur Begrüßung aller: "Die Debatte ist keine Diskussion und kein Streit. Sie ist ein Sport. Wir spielen nach klaren Regeln!" In der Runde sitzt das Bildungsbürgertum: Journalisten, eine Rechtsanwältin, ein Informatiker, eine Grundschullehrerin. Eine Hälfte Männer, die andere Frauen. Eine begründet ihr Kommen mit: "Ich will schlagfertiger werden." Jemand anders: "Ich will mein Lampenfieber in den Griff bekommen." Zustimmung in der Runde.
Das Format, das der Verein anwendet, heißt Offene Parlamentarische Debatte, kurz OPD. Es ist eine Art Auseinandersetzung ähnlich der Bundestagsdebatte: nüchtern, mit Regeln für Sprechzeiten, Wortwechsel und Zwischenfragen. Es gibt immer zwei Gruppen à drei Menschen, die gegeneinander argumentieren: die Regierung (dafür), die Opposition (dagegen). Der Rest aus dem Publikum kann sich – wie ich – für einen freien Redebeitrag melden, um die Argumente einer Seite zu unterstützen. "Wir suchen hier keinen Konsens und müssen am Ende nicht einer Meinung sein", erklärt der Vorstandskollege. Das Debattenthema wird ein paar Tage zuvor bekannt gegeben, so kann man sich seine Argumente gründlich zurechtlegen.
Das Interessante an so einer fiktiven Debatte: Man kann in Rollen schlüpfen und Argumente vertreten, die im Alltag gar nicht der eigenen Meinung entsprechen. Benkenstein sagt: "Wir schaffen einen geschützten Raum, damit sich die Leute ausprobieren können. Man kann auch mal eine extreme Position vertreten. Grundlage ist der Respekt füreinander." Feine Redekunst zeige sich, wenn man das Argument des Gegners aufgreifen, interpretieren und gegen ihn verwenden kann. Benkenstein gibt den Tipp, dass man erst mal die Worte des anderen wiederholt, bevor man seine eigenen ausrollt. So signalisiere man: Ich habe dich verstanden, sehe es aber anders.
Verstehen mich die Leute nicht direkt? So what!
Geht es um Schlagfertigkeit, kommt man in Deutschland um den Kommunikationsexperten Matthias Nöllke nicht herum. Seit über 20 Jahren schreibt er Bücher zu dem Thema. Der Titel Schlagfertigkeit ist eine Art Handbuch für gutes Argumentieren, auf dem Cover ist ein Paar Boxhandschuhe abgebildet. Nöllke schreibt, es "geht nicht darum, einfach nur witzige oder gar freche Antworten zu finden". Es gehe immer darum, die eigene "Souveränität", sogar die "persönliche Würde", zu bewahren. Damit meint er: Wer sich nicht unterkriegen lässt, fühlt sich am Ende besser.
Nöllkes zentrale These ist: überhaupt etwas sagen. Wenn man von einem verbalen Angriff überrumpelt wird, schweigt und es hinnimmt, fühle man sich häufig ohnmächtig. Diese Blockade müsse man durchbrechen – das sei der erste Schritt und die einfachste Form der Selbstbehauptung. Nöllke empfiehlt dafür "Nullsätze". Also Aussagen, die man immer bringen kann. Ein knappes "Aha!" oder "Oookay!" mit hochgezogener Augenbraue signalisiere Geringschätzung. Der Satz "Ich habe Sie nicht verstanden" zwinge den Angreifer zur Wiederholung und schwäche damit sein Argument – denn wie gut ist ein spitzer Kommentar, wenn man ihn wiederholen muss?
Ihr Tipp: Ankommen, Anschauen, Ausatmen, Anfangen
Oft helfe auch das klassische "Schön für dich!". Nöllke schreibt, dass es sinnvoll ist, sich mental zu wappnen – am besten mit einem imaginären Schutzschild. Das könne ein Helm, ein Schutzanzug oder eine Glashaube sein, die man sich vorstellt, während man sich sagt: Angriffe treffen mich nicht. Es soll dabei helfen, das Gesagte des Gegenübers nicht auf sich zu beziehen. Denn die eigene Schlagfähigkeit lähmt es am meisten, wenn man das Gesagte persönlich nimmt, sogar wenn es persönlich gemeint war. Begib dich nie auf das gleiche Niveau!
Vor Kurzem war ich Teil der Finalistinnen und Finalisten für ein Austauschstipendium. Zwei Tage saß ich mit 30 ambitionierten Kolleginnen und Kollegen in einem Raum, und wir hörten uns Vorträge von Politikern, Historikern und Diplomatinnen an. Am Ende stellten wir Fragen. Ich wollte mit besonders wasserdichten aus der Gruppe hervorstechen. Mein Kopf raste: "Etwas Kluges, etwas Kluges, komm schon!" Und dann stellte jemand anders die Frage, auf der ich seit zehn Minuten herumdachte. Wie schafft man es, auch vor Gruppen sicher aufzutreten?
Nutella ist gesund. Das waren doch auch schon Fake-News.
Bevor die Debatte in der Kneipe beginnt, bekommen die anderen Redner und ich 15 Minuten Zeit, unsere Argumente vorzubereiten. Ich setze mich an den Bartresen neben Vincent, 25, der seit einem Jahr dabei ist. "Ich will zeigen, dass es Fake-News schon im letzten Jahrhundert gab, ein Verbot macht keinen Sinn", sagt er. Ist er aufgeregt? "Ne, eher voller Vorfreude", sagt er. "Das Debattieren hat mir geholfen." Vincent habe Mut zur Unvollkommenheit entwickelt und sorge sich nicht über die Stichhaltigkeit seines Arguments. "Nutella ist gesund. Das waren doch auch schon Fake-News", sagt er und kritzelt ein paar Sätze auf seinen Zettel. Er will ein witziges Argument bringen. Auch auf die Gefahr hin, es könnte albern wirken.
Wer schlecht im Improvisieren ist, kann den Mangel mit guter Vorbereitung wettmachen. Diesen Weg habe ich gewählt, als ich am Vortag Sabine Walter, 50, zu einem Videocall treffe. Sie ist Unternehmensberaterin und hat zehn Jahre in Fach- und Führungsrollen in der Industrie verbracht, zuletzt bei Bertelsmann. Heute gibt sie unter anderem Schlagfertigkeitstrainings. "Schlagfertigkeit heißt, destruktive Energie von Grenzüberschreitungen abfangen und umleiten", sagt Walter. "Sie müssen sich das vorstellen wie Kung-Fu." Ich denke an den imaginären Schutzschild von Nöllke, den Walter auch gelesen hat. Für Walter ist klar – egal ob in einer Debatte, in einem Streit oder Disput: "Lassen Sie sich vom Ton Ihres Gegenübers nicht einschüchtern."
Walter glaubt, dass sich unser Schlagfertigkeitsvermögen in verschiedenen Lebensphasen bis zum Erwachsenenleben formt. "Als Kinder und Jugendliche lernen wir, wie wir uns in überfordernden Situationen behaupten können, und entwickeln bestimmte Schutzstrategien. Diese sind beispielsweise: 'Ich darf nicht widersprechen', 'Ich muss freundlich sein', 'Was ich mache, muss perfekt sein'." Diese "Glaubenssätze" sind nach Walter Teil von uns, ließen sich aber verändern. Sie sagt außerdem, dass 90 Prozent ihrer Kundinnen und Kunden weiblich sind. "Es gibt einen Gendergap: Frauen vertrauen weniger auf ihre Schlagfertigkeit." In der Kneipe beobachte ich dieses Verhältnis ebenfalls: neun Männer melden sich als Redner für die Debatte – und nur eine Frau.
Die Reaktion muss nicht sofort kommen. Sie haben immer zwei bis drei Sekunden, um zu reagieren.
Wie Nöllke empfiehlt Walter ein Repertoire an Kontern, die man immer abrufen kann. "Das gibt Sicherheit. Die Reaktion muss nicht sofort kommen. Sie haben immer zwei bis drei Sekunden, um zu reagieren", sagt sie. Für Menschen mit Lampenfieber empfiehlt sie außerdem für die nächste Präsentation vor einer Gruppe die vier A: Ankommen, Anschauen, Ausatmen, Anfangen. Daran erinnere ich mich, als ich am Pult angekommen bin. Ich schaue bewusst in die Gesichter des Publikums und sehe Neugierde. Ich vertraue ihnen, mich nicht zu zerhacken. Ich drücke auf die Stoppuhr, die vor mir liegt. 3:30 Minuten für meinen Redebeitrag zählen runter.
Ein Knall. Ich zucke zusammen. Die ersten 60 Sekunden sind um
Es kann losgehen, ich atme aus und spüre, wie ich lockerer werde. "Wir haben von der Regierung einige Argumente für ein Verbot der Verbreitung von Fake-News gehört, nun will ich die Debatte als Journalist mit Inhalt füllen", sage ich selbstbewusst und beginne meinen Vortrag im Sinne der Opposition. Ich spreche über die Unabhängigkeit der Medien, über die Gefahr, dass ein Verbot gezielt gegen die Pressefreiheit verwendet werden könnte und darüber, dass es mehr Faktenchecks brauche.
Ein Knall. Ich zucke zusammen. Die ersten 60 Sekunden sind um, der Debattenleiter schlug mit dem Richterhammer auf den Tisch. Sein Zeichen, dass ab jetzt Zwischenfragen und Wortmeldungen erlaubt sind. Benkenstein ist Regierungsmitglied und steht direkt mit erhobener Hand auf. Ich taxiere ihn im Augenwinkel und sage: "Jetzt nicht!" Zwischenfragen müssen nicht angenommen werden. Er setzt sich wieder, und ich denke: Das war einfach.
Dann meldet sich Benkenstein wieder. Mit einer kurzen Handbewegung schicke ich ihn auf seinen Platz und rede weiter. Erst beim dritten Mal frage ich: "Ja?" Er wirft ein, dass sich meine Argumente zu seinen kaum unterscheiden. "Das stimmt nicht, und weiter kann ich darauf nicht eingehen", sage ich. Er setzt sich. Ich beende meine Redezeit damit, dass die Regierung journalistische Vielfalt fördern sollte, anstatt Verbote zu erlassen. Das Publikum applaudiert. Ich fühle mich gut, weil ich die Angriffe pariert habe.
Anschließend werden noch einige Argumente hin- und hergeworfen, abgewogen und das Rednerpult von anderen umklammert. Am Ende des Abends wird mir klar, dass Schlagfertigkeit oft mehr mit Vorbereitung und innerer Haltung zu tun hat als mit Spontaneität. Gibt es Gegenwind? So what! Verstehen mich die Leute nicht direkt? So what! Schlagfertig zu sein bedeutet auch, dass man ein bisschen lockerer mit sich selbst ist.
© ZEIT Campus (Zur Original-Version des Artikels)



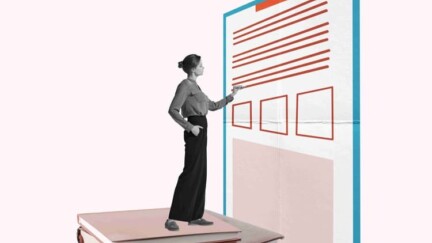
![Eine Frau wird von verschiedenen Geräten aus dem Arbeitsalltag – Block, Laptop, Taschenrechner, Bücher – umkreist [© master1305 – stock.adobe.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Symbolbilder/_card/3220353/Aufgaben-Verantwortung-Multitasking.jpg)