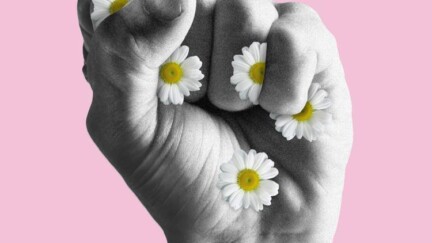Soft Skills: Den eigenen Arbeitswert im KI-Zeitalter sichern
- Sophia von Schwanewede
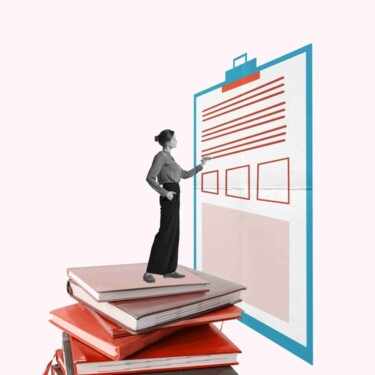
master1305 - stock.adobe.com
Es heißt, Beschäftigte sollen auf das setzen, was KI nicht kann: Teamfähigkeit, Empathie, Kreativität. Was am Hype um Soft Skills dran ist – und wie man unverzichtbar wird.

e‑fellows.net präsentiert: Best of Handelsblatt
Das Handelsblatt ist die Nummer eins unter den Finanz- und Wirtschaftzeitungen in Deutschland. Lies bei uns kostenlos ausgewählte Artikel aus der Printausgabe.
Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Arbeitswelt und droht bestimmte Jobs bald überflüssig zu machen: Schon heute kann sie juristische Verträge formulieren, Krankheiten präzise diagnostizieren oder Investmententscheidungen innerhalb von Millisekunden treffen. Die Folgen sind in Unternehmen spürbar: 40 Prozent der Arbeitgeber rechnen damit, dass sie bis 2030 Stellen abbauen werden, weil diese bis dahin durch KI ersetzt werden können. Das ergab der "Future of Jobs Report" des Weltwirtschaftsforums.
Bereits heute reduziert die Technologie die Nachfrage nach Berufseinsteigern enorm, wie das Handelsblatt kürzlich berichtete. Für Beschäftigte stellt sich daher die Frage, wie sie im KI-Zeitalter attraktiv für den Arbeitsmarkt bleiben. Als Antwort darauf verweisen Expertinnen und Experten gern auf ein vermeintliches Erfolgsrezept: Beschäftigte sollen auf sogenannte Soft Skills setzen, also persönliche, zwischenmenschliche oder methodische Kompetenzen wie Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit oder Stressresistenz. Aber reichen Soft Skills wirklich aus, um am Arbeitsmarkt unverzichtbar zu bleiben?
Tatsächlich ist die Liste der Fähigkeiten lang, die für Arbeitnehmer als unverzichtbar gelten: Neugier, Kommunikationsstärke, kontinuierliche Lernbereitschaft und emotionale Intelligenz nannte etwa der Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberatungen (BDU), Harald Fortmann, jüngst im Gespräch mit dem Handelsblatt. In anderen Medienberichten verweisen Fachleute auf Eigenschaften und Fähigkeiten wie Resilienz, Empathie, Kreativität oder Agilität. All diese Begriffe sind ausreichend schwammig, um Beschäftigte in Sicherheit zu wiegen. Wer würde schon von sich behaupten, unempathisch, wenig lernbereit und festgefahren in den eigenen Denkweisen zu sein? Genau darin liegt das Problem, sagt Yasmin Weiß, Professorin für Betriebswissenschaften und Expertin für Zukunfts-Skills. Vieles, was in Bewerberforen, Medienberichten oder Beiträgen auf Plattformen wie LinkedIn zum Thema Soft Skills kursiere, sei eher "hemdsärmelig kuratiert" als wissenschaftlich fundiert. Dazu komme, dass niemand heute genau sagen könne, welche Tätigkeiten die KI einmal genauso gut ausführen könne, wie es heute der Mensch tut.
"Noch vor acht Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass KI auch kreativ sein kann", sagt Weiß. Heute zeigt etwa eine Studie von Studierenden der University of Arkansas, dass sie es doch kann. Forscher ließen 151 Menschen und das KI-Sprachmodell ChatGPT-4 dafür dieselben Kreativtests machen. Die Teilnehmenden sollten zum Beispiel alternative Verwendungen für Alltagsgegenstände finden oder hypothetische Szenarien durchdenken. Das Ergebnis: Die KI ist längst in der Lage, innovative Lösungen und kreative Ansätze zu entwickeln – und übertrifft dabei sogar die menschlichen Leistungen. Auch Empathie ist kein menschliches Alleinstellungsmerkmal mehr. So sind KI-Modelle wie ChatGPT inzwischen in der Lage, durch Wortwahl, Satzbau oder Kontext Emotionen zu erkennen und basierend darauf einfühlsame Antworten zu generieren. Sie simulieren Empathie auf Basis von Datenmustern. "Was KI nicht kann, ist die tiefe zwischenmenschliche Interaktion", erklärt Weiß. "Sie erkennt nicht, ob Menschen wirklich aufmerksam sind, und kann sich nicht situativ an die Stimmung des Gesprächspartners anpassen."
Eine Managemententscheidung des schwedischen Fintechs Klarna zeigt die Grenzen der KI-Empathie auf: Das Unternehmen hatte zunächst Callcenter-Mitarbeitende durch KI-Assistenten ersetzt. Weil man mit der Qualität der Gespräche nicht zufrieden war, hat Klarna diese Strategie im Mai 2025 wieder geändert. Klarna will nach eigenen Angaben nun, dass KI-Assistenten und Menschen Hand in Hand arbeiten: Standardisierte Fragen beantwortet die KI, um komplexere Themen kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es werde immer Situationen geben, in denen der Mensch gegenüber der KI einen Vorteil hat, gerade in Bereichen wie dem Kundenservice, sagt Expertin Weiß. Doch sie bleibt dabei: "Soft Skills allein machen uns nicht beschäftigungsfähig." Was Beschäftigte bräuchten, sei eine Kombination aus technologischer Anwendungskompetenz und sozialen Fähigkeiten.
Anstatt ständig zu fragen, wie die eigenen Jobs vor der KI geschützt werden können, sollten Arbeitnehmer lieber erkunden, welche neuen Chancen und Möglichkeiten die Technologie eröffnet. "Die KI ist eine transformative Technologie. Wir müssen unsere Prozesse an diese neuen Möglichkeiten anpassen und komplett neu ausrichten", sagt Matthias Peissner, Leiter des Forschungsbereichs Mensch-Technik-Interaktion beim Fraunhofer IAO. Soft Skills seien "unverzichtbar, um uns zukunftssicher zu machen", sagt Peissner. Drei Fähigkeiten nennt er, die menschliche Arbeitnehmer im KI-Zeitalter wirklich unersetzbar machen:
Zukunfts-Skill 1: Kommunikation in komplexen Situationen
KI kann bereits einfache Kommunikationsaufgaben übernehmen, etwa E-Mails beantworten, Termine vereinbaren oder Kundenanfragen nach Mustern bearbeiten. "Sobald es komplexer wird, muss aber ein Mensch dazu", erklärt Peissner.
Das zeigt sich besonders in Situationen wie Gehalts- oder Vertragsverhandlungen, in denen Argumente spontan angepasst, Widerstände erkannt und Kompromisse ausgehandelt werden müssen. "Eine KI bringt keine echte Persönlichkeit mit", sagt Peissner. Sie kann zwar Vertragsklauseln analysieren – aber weder die Körpersprache des Verhandlungspartners deuten noch erspüren, wann der richtige Zeitpunkt für ein Zugeständnis gekommen ist. Auch in der Mitarbeiterführung wird diese Fähigkeit entscheidend. Zwar kann KI messen, wie viel Output ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin liefert und wie gut seine oder ihre Leistung ist. Lässt ein normalerweise produktives Teammitglied aber zum Beispiel dauerhaft nach, braucht es eine feinfühlige Führungskraft, die den Gründen dafür nachgeht. "Einer menschlichen Führungsperson, deren Gefühle und Wünsche, Stärken und Schwächen ich kenne und dessen Verhalten ich nachvollziehen kann, der kann ich vertrauen", sagt Peissner. Das hätte eine KI nicht zu bieten. Chefinnen und Chefs werden auch in Zukunft zwischen den Zeilen lesen und ein Gespür dafür haben müssen, wie sie ihre Leute motivieren können.
Zukunfts-Skill 2: Neugier als Karriere-Motor
Wer in einem Umfeld bestehen will, das durch KI ständig verändert wird, muss neugierig sein und Lust auf neue Tools, Arbeitsweisen und Produkte haben. "Sie sollten in der Lage sein, sich schnell in neue Situationen einzuarbeiten, Neues zu lernen, und Freude daran haben, Dinge auszuprobieren", sagt Peissner. Die gute Nachricht: Neugier kann man lernen. Der Wissenschaftler empfiehlt, öfter etwas Neues auszuprobieren und sich aus einer gewohnten Routine herauszubewegen, auch wenn es nur um Kleinigkeiten geht. "Neue KI-Tools eignen sich dafür besonders gut", sagt Peissner. Beispielsweise könne man ausprobieren, eine Illustration eines abstrakten Zusammenhangs für eine Präsentation zu generieren.
Außerdem könne man bewusst Projekte angehen, die eigentlich außerhalb der Komfortzone liegen – egal, ob diese am Ende erfolgreich verlaufen oder nicht. "Denn neue Erfahrungen erweitern die Perspektive, bauen Ressourcen auf und führen zu mehr Offenheit für weitere neue Erfahrungen", meint der Experte.
Zukunfts-Skill 3: Mit KI ein Team bilden
Es gibt kaum eine Stellenausschreibung, in der "Teamfähigkeit" nicht als Teil des Anforderungsprofils genannt wird. Sie wird auch weiterhin eine große Rolle spielen – aber anders, als wir den Begriff heute verstehen. Peissner zufolge müssen Menschen lernen, nicht nur mit anderen Menschen im Team zu funktionieren, sondern auch mit der KI.
"Das große Potenzial der KI liegt nicht darin, dass man irgendwelche menschlichen Tätigkeiten mehr schlecht als recht automatisiert, sondern dass man Dinge leisten kann, die wir Menschen allein eben nicht können", so der Experte. Wer im Job Erfolg haben wolle, dürfe die KI nicht als Konkurrenz betrachten – sondern müsse sie als Partnerin sehen. New-Work-Expertin Weiß pflichtet ihm bei: "Wir Menschen sind die Kapitäne, die KI-Systeme sind unsere Co-Piloten." Menschen würden weiterhin das Ziel vorgeben, steuern und kontrollieren, was geschieht. Sie trügen Verantwortung für Prozess und Ergebnis – besonders im Krisenfall. Die KI assistiere dabei.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.



![Eine Frau wird von verschiedenen Geräten aus dem Arbeitsalltag – Block, Laptop, Taschenrechner, Bücher – umkreist [© master1305 – stock.adobe.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Symbolbilder/_card/3220353/Aufgaben-Verantwortung-Multitasking.jpg)