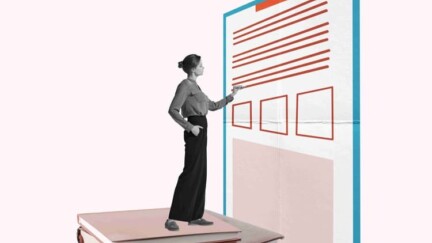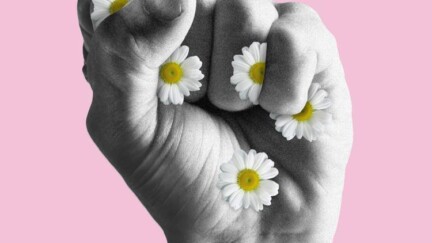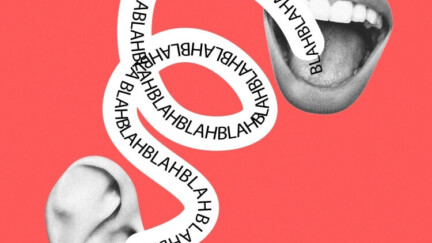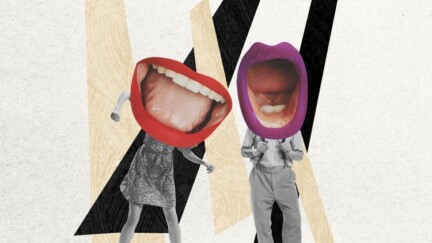Singletasking: Multitasking ist auch nur ein Mythos
- Jennifer Spatz
![Eine Frau wird von verschiedenen Geräten aus dem Arbeitsalltag – Block, Laptop, Taschenrechner, Bücher – umkreist [© master1305 – stock.adobe.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Symbolbilder/_articleImageSmall/3220353/Aufgaben-Verantwortung-Multitasking.jpg)
master1305 – stock.adobe.com
Multitasking, das klingt nach effizienter Arbeit und besonderem Talent. Doch das Gegenteil ist der Fall. Denn Experten wissen schon lange, was wirklich produktiv macht.

e‑fellows.net präsentiert: Das Beste aus ZEIT Online
Lies bei uns ausgewählte Artikel von ZEIT Online, Deutschlands führendem Portal für anspruchsvollen Online-Journalismus.
Wer versucht, alles gleichzeitig zu erledigen, scheitert oft. Struktur ist sowohl im Job als auch im Privatleben wichtig – und lässt sich trainieren. Experten erklären, welche Methoden dabei helfen und wie man sich diszipliniert.
Übersicht
Warum ist Multitasking schlecht?
Warum fällt es so schwer, eins nach dem anderen abzuarbeiten?
Weshalb fühlt man sich oft nur produktiv, wenn man viele Dinge gleichzeitig tut?
Wie schafft man Singletasking?
Warum ist Multitasking schlecht?
Das menschliche Gehirn kann nur konzentriert an einer Aufgabe arbeiten. "Die Sensorik und Motorik des Menschen sind begrenzt. Dazu laufen im Gehirn ständig Kontrollprozesse ab, die Zeit brauchen", sagt Andrea Kiesel, Leiterin des Lehrstuhls für allgemeine Psychologie an der Universität Freiburg. Auch könne der Mensch seine Aufmerksamkeit nur auf eines richten und nicht teilen.
Trotzdem gibt es Aufgaben, die Menschen parallel erledigen können – solche, die nicht viel Aufmerksamkeit und Denkarbeit erfordern. Beispielsweise, wenn man die Spülmaschine ausräumt, während man auf den Wasserkocher wartet.
Es kann auch sinnvoll sein, ab und zu die Aufgaben zu wechseln. Zum Beispiel dann, wenn die Konzentration nachlässt oder einem die Ideen ausgehen. Dann kann es für neue Motivation sorgen, etwas anderes einzuschieben. "Wenn Menschen es sich aussuchen können, haben sie lieber etwas Abwechslung, als acht Stunden monoton das Gleiche zu machen", sagt Kiesel.
In der Regel gilt bei Multitasking aber: Es bringt keinerlei Effizienzgewinn, im Gegenteil. Das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben kann die Produktivität sogar um bis zu 40 Prozent schmälern.
Denn dieses Hin- und Herspringen kostet das Hirn Energie. Deshalb empfehlen Expertinnen und Experten, einen Arbeitsschritt nach dem anderen zu erledigen – Singletasking also.
Warum fällt es so schwer, eins nach dem anderen abzuarbeiten?
"Das hängt mit der Stimulus-Kontrolle zusammen", sagt Kiesel. "Der Mensch hat ständig die Möglichkeit, sich einen neuen Reiz zu holen. Deshalb neigt er zum Multitasking."
Heißt: Es kommt eine Mail rein, die Augen wandern zur Nachricht. Ring, das Handy klingelt, da geht man halt kurz ran. "Das ist heute ein größeres Problem als noch vor wenigen Jahrzehnten. Ein Büroarbeitsplatz in den Sechzigerjahren sah ganz anders aus", sagt Kiesel. Damals lagen dort einzelne Blätter, vielleicht ein paar Ordner, daneben stand eine Schreibmaschine. Heute haben die meisten Wissensarbeiter mehrere Bildschirme mit vielen offenen Fenstern und Tabs, das private Smartphone vibriert auch noch auf dem Schreibtisch.
Viele Angestellte haben auch beruflich mit Social Media zu tun. Das kann besonders fatal sein. Denn den Umstand, dass das menschliche Gehirn gerne stimuliert wird, nutzen auch die sozialen Netzwerke. Immer wieder ploppt eine Benachrichtigung auf, es erscheint etwas Neues im Feed – eine Endlosschleife.
Weshalb fühlt man sich oft nur produktiv, wenn man viele Dinge gleichzeitig tut?
Das Gefühl, nur produktiv zu sein, wenn man maximal beschäftigt ist, viele Termine hat und mehrere Dinge gleichzeitig tut, nennt sich umgangssprachlich Hustle Culture. Wer dabei mitmacht, jagt den ganzen Tag lang To-dos hinterher, fühlt sich gut und denkt, besonders viel zu schaffen.
In der Realität schaffen Menschen damit aber weniger, denn sie tun sich schwer, Aufgaben abzuschließen. "Am Abend sind diese Menschen total erschöpft und denken trotz aller Anstrengung: Eigentlich habe ich gar nichts geschafft heute", sagt Kiesel.
Denn Beschäftigt sein ist nicht gleich Produktivität oder Effizienz. Zusätzlich wirkt sich das negativ auf die mentale Gesundheit aus. Menschen, die bei der Hustle Culture mitmachen, haben Studien zufolge eher eine schlechte Work-Life-Balance, was auf Dauer Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen begünstigen kann.
Außerdem haben sie laut Studien Angst, hinter ihren Kollegen zurückzubleiben, weshalb sie immer mehr davon machen. Zusätzlich leben Führungskräfte ihnen oft Multitasking vor, indem sie scheinbar alles gleichzeitig erledigen. Dadurch entsteht das Gefühl, nur produktiv zu sein, wenn man möglichst viel gleichzeitig tut – so wie alle anderen. Das Gute ist: Man muss da nicht mitmachen.
Wie schafft man Singletasking?
Dafür gibt es einige Techniken und Kniffe. Am Ende kommt es aber immer auf eines an: Für erfolgreiches Singletasking muss man Aufgaben priorisieren. "Nur wer eine klare Reihenfolge festlegt, kann auch eins nach dem anderen angehen", sagt Kiesel.
Damit man sich daran auch hält und nicht doch wieder alles irgendwie gleichzeitig macht, sollte man eine klassische To-do-Liste schreiben. So geht auch keine Aufgabe verloren, nur weil sie auf später vertagt wurde.
Noch besser ist es, Zeitslots im Kalender einzuplanen. "Das hilft besonders bei großen Denkaufgaben, wenn man zum Beispiel Texte schreibt oder Konzepte erstellt", sagt Susanne Schwerdtfeger, Coachin für Führungskräfte. "In dieser Zeit schließen Büroarbeiter am besten auch ihr Mailprogramm, stellen sich im Chat auf Nicht-Stören und leiten das Telefon nach Absprache auf ein anderes Teammitglied um." Fokuszeit nennt sich das dann. Auch Noise-Cancelling-Kopfhörer können in lauten Umgebungen Ruhe verschaffen.
Damit die Fokuszeit wirklich gelingt, ist es am besten, diese auch den Kolleginnen und Kollegen mitzuteilen. Wer ein Einzelbüro hat, kann morgens die Tür schließen fürs konzentrierte Arbeiten – und nachmittags die Tür öffnen und damit signalisieren: Komm gerne rein! In dieser Zeit kann man dann leichtere Aufgaben legen, die weniger Konzentration erfordern.
Hilfreich ist außerdem die Pomodoro-Technik. Bei dieser stellt man sich einen Timer für zum Beispiel 25 Minuten und macht dann fünf Minuten Pause. Nach drei bis vier Stunden gibt es eine große Pause. Sowohl Coachin Schwerdtfeger als auch Psychologin Kiesel verwenden Pomodoro in ihrem Alltag. "Menschen vergessen schnell, dass sie fürs produktive Arbeiten auch aktive Pausen brauchen. Also regelmäßig aufstehen, etwas laufen, die Augen in die Ferne schweifen lassen und bloß nicht aufs Handy schauen", sagt Kiesel. Wer keine Pausen macht und bis zur totalen Erschöpfung arbeitet, braucht länger für die Regeneration.
Außerdem müssen Menschen lernen, Nein zu sagen. Am besten sagt man dann nicht "Ich habe keine Zeit dafür", sondern "Ich nehme mir die Zeit jetzt nicht", sagt Schwerdtfeger. Entweder muss dann jemand anderes aus der Belegschaft ran oder man macht sich selbst einen Termin, wann man sich darum kümmert.
Gibt es Berufe, in denen Singletasking nicht möglich ist?
In der Notfallmedizin, sagen Kiesel und Schwerdtfeger. Klar, in Notfällen müssen oft viele Dinge gleichzeitig passieren. "Das können Mediziner, Rettungs- und Pflegekräfte aber sehr gut, darauf sind sie trainiert", sagt Schwerdtfeger.
Am schwierigsten haben es ansonsten Menschen im Homeoffice mit Kindern. "Da ist Singletasking fast ausgeschlossen, weil es nicht nur viele Umweltreize gibt, sondern man auch auf sie reagieren muss. Wenn ein Kind weint, kann ich es ja nicht ignorieren. Eine Mail hingegen schon", sagt Kiesel.
Ist Singletasking auch im Privatleben möglich?
Ja, aber auch hier gilt: Mit Kindern wird es schwer. Allgemein helfen große und kleine Fokuszeiten, Rituale und feste Abläufe. Wenn der Morgen und die Zeit vor dem Zubettgehen immer gleich ablaufen, übernimmt irgendwann der Autopilot. Zusätzlich sollte man, wenn immer möglich, sich Zeit für eine einzige Sache nehmen. Also einfach nur zu Abend essen und nicht nebenbei streamen oder noch schnell etwas für die Arbeit erledigen.
© ZEIT ONLINE (Zur Original-Version des Artikels)