Psychologin im Interview: "Viele Studierende grübeln zu viel"
- Ursula Kals
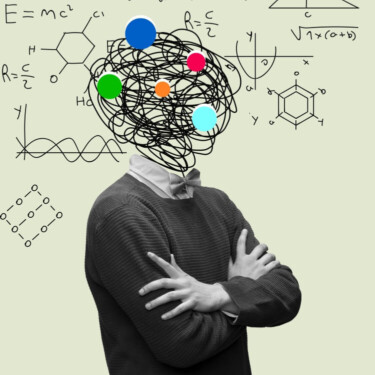
master1305 – stock.adobe.com
Die Psychologin Britta Cornelißen berät Studenten, die unter Selbstzweifeln leiden. Im Interview erklärt sie, was Handyzeiten und dauerndes Vergleichen damit zu tun haben – und wie sich das Selbstvertrauen stärken lässt
e‑fellows.net präsentiert: Das Beste aus der F.A.Z.
Lies bei uns ausgewählte Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und von FAZ.NET.
Frau Cornelißen, Sie sagen, neben manchen unangenehmen Selbstüberschätzern begegnet Ihnen bei Ihrer Arbeit als Coach und Wirtschaftspsychologin an Hochschulen eine ganz andere Gruppe, nämlich die Selbstzweifler. Was ist deren Problem?
Sie grübeln zu viel, leiden unter Schlafstörungen, haben Prüfungsangst. Das betrifft immer mehr junge Menschen. Laut der Techniker Krankenkasse kratzen 68 Prozent der Studierenden am Burnout. Das merke ich in meinen Seminaren. Bei manchen geht das bis zu Panikattacken und Angststörungen. Ein großes Thema sind Depressionen.
Woran liegt das in Ihren Augen?
Die Welt ist so viel komplexer, das Leben ist teurer geworden. Verschärfend kommt hinzu, dass viele hohe Ansprüche und Erwartungen an sich selbst stellen. Das erhöht den Druck. Ich begegne immer mehr Studierenden, die arbeiten mehr, als ihnen guttut, weil sie das einfach müssen, sonst können sie sich nicht finanzieren, das Studium gerät in den Hintergrund. Es gibt ein krasses Problem, was Vereinbarkeit von Studium, Job, Freizeit betrifft, also das, worüber wir im Mütterkontext immer reden.
Ist das nicht auch eine Frage des erhofften, hohen Lebensstandards?
Das mag hin und wieder zutreffen. Zu mir kommen aber viele, die ganz normal in einer WG wohnen, da kommt es darauf an, in welcher Stadt und in welchem Viertel sie leben. Natürlich möchten sie auch Urlaub machen, sich etwas gönnen, so wie die anderen. Das alles ist teurer geworden. Ich erinnere mich an mein Studium, ich musste die Miete zusammenkriegen und habe auch gearbeitet, aber die Uni war nie im Hintergrund, die habe ich als Hauptjob gesehen.
Selbstzweifel gehören aber zu jedem Leben.
Ein bestimmtes Maß an Selbstzweifeln ist für uns wichtig, weil es uns voranbringt. Wenn ich nicht weiß, wie ich den ganzen Stoff lernen soll, komme ich in die Überlegung, wie ich das künftig kreativ machen kann. Dann gibt es einen konkreten Anlass wie eine schwierige Prüfung. Es ist aber nicht gut, wenn diese Zweifel meine ganze Person betreffen.
Wie lässt sich dieser Zustand überwinden?
Oft fehlt es an Pausen. Öfter zehn Minuten um den Block gehen, schon drei solcher Mikropausen am Tag sorgen für eine krasse Veränderung. Ich sollte durchatmen, mir Zeit für Selbstreflexion nehmen: Wer bin ich, was sind meine Stärken, was mag ich an mir, was lief im letzten Semester gut, was habe ich an Erfolgen einheimsen können, nicht nur bezogen auf Noten? Ich gebe auch Seminare für Persönlichkeitsentwicklung, beispielsweise an der FH Münster, da treffe ich auf Studierende, die sich damit souverän auseinandersetzen.
Was befeuert Unsicherheiten?
Wir leben in einer zunehmenden Vergleichskultur, das belastet sehr. Vor allem Mädchen und Frauen lassen sich von Social Media und dieser riesigen Vergleichsgruppe blenden. Sie nehmen das wahr, was sie nicht haben. Influencerinnen zeigen nur wenige Prozent ihres echten Alltags, mit der Wirklichkeit hat das wenig zu tun.
Junge Männer holen in puncto Körpervergleichskult aber mächtig auf.
Studien unterstreichen das. Die Jungs reden weniger über Gefühle, aber sie leiden, wenn sie mit Ausdrücken wie Weichei oder Muttersöhnchen runtergeputzt werden. Mit dem Anspruch, als Mann musst du stark sein, keinen Schmerz kennen, sind nochviele Studierende aufgewachsen. Ihnen wurde nicht beigebracht, vernünftig über Gefühle zu sprechen. Die Suizidrate bei Jungen ist deutlich höher.
Erreichen Sie denn junge Männer mit Ihrem Beratungsangebot?
Ich habe inzwischen ein Drittel Männer. Diejenigen, die kommen, empfehlen es weiter an ihre Freunde und erleben, wie gut Austausch tut. Dazu trägt bei, dass ich mit meinem ausgebauten Van unterwegs bin und auf dem Campus stehe. Da ist die Hemmschwelle nicht so groß. Oder ich gebe Seminare, zum Beispiel an der Universität Gießen zum Stressmanagement, die dauern ein Semester, dann tauen viele auf.
Wie schwinden Selbstzweifel und Stress?
Mein erster Tipp: Verkürzt eure Bildschirmzeit! Viele sind ständig erreichbar, werden permanent unterbrochen und wollen sich mit Multitasking helfen. Unser Gehirn kann sich nicht auf mehrere Dinge gleichzeitig konzentrieren, die Synapsen werden immer wieder gestört, Arbeiten dauern länger, wir machen Fehler. So toll Social Media uns Menschen zusammenbringt - wir sehen das auf Dating-Ebene -, so problematisch ist es, immer ungefiltert direktes Feedback zu erhalten, das selten konstruktiv ist. Viele haben mit Shitstorms und Hatespeech zu tun. Ich verbringe Stunden damit, die Studierenden vom Handy wegzubringen, es hat enormen Suchtfaktor.
So diskutieren die e-fellows über das Thema in der Community
Was hilft konkret, sich vom Handy zu lösen?
Es nicht im Schlafzimmer zu haben. In einer WG ist das nicht immer einfach umzusetzen, aber man sollte es zumindest in eine Schublade legen, sodass man es nicht immer sieht. Manchmal lautet die wildeste Erkenntnis: Ich kann mir einen Wecker besorgen und brauche das Handy nicht neben dem Bett. Klare Fokus-Zeiten und der Nicht-Stören-Modus helfen. Beim Tracken der Bildschirmzeit kommen bei den meisten erschreckend viele Stunden zusammen. Zwei Studierende fand ich inspirierend: Eine hat ihren Instagram-Account mit Code verschlüsselt und ist nur 15 Minuten am Tag dort unterwegs. Den Code hat nur ihre Freundin, die muss sie anrufen, das hat sie sich selbst auferlegt. Eine Studentin hat eine App installiert, mit der sie zur Belohnung digitale Bäume pflanzt, wenn sie längere Auszeiten hat.
Mehr analoge Begegnungen sind ein Bollwerk gegen Einsamkeit, unter der auch immer mehr Studenten leiden.
Wir sehen in Untersuchungen, Social Media geht mit Verlust von wichtigen Lebenserfahrungen einher, schon Kinder zocken viel zu viel und erleben keine kindlichen Abenteuer. Das setzt sich so fort, und psychische Probleme nehmen zu. Die ausführlichste Studie zum Wert sozialer Beziehungen ist an der Universität Harvard entstanden – was langfristig hilft, um glücklich zu leben, sind soziale Beziehungen. Ich höre immer wieder, ich habe keine Zeit fürs Kino, ich kann mir keine Cafépause mit Freunden gönnen. Wir verbieten uns die schönen Sachen und meinen, uns das nicht erlauben zu dürfen. Da entsteht eine große Dysbalance. Gerade wenn der Stress groß ist, braucht man Pausen und schöne Erlebnisse. Wir stolpern immer wieder über den Begriff Resilienz, aber die Widerstandskraft, mit Rückschlägen umzugehen, nimmt ab.
Was hilft, um resilienter zu werden?
Die bewährten Wege aus der Stressbewältigung: raus in die Natur, bewusster atmen, Meditation, grundsätzlich Pausen machen, etwas lesen, in die Ferne gucken, Musik hören, in Bewegung kommen – alle Formen von Sport sind immer gut, um Stress abzubauen.
Solche Tipps offeriert jedes Drogeriemarkt-Magazin.
Aber wer sie umsetzt, dem geht es besser. Das Wichtigste dabei ist, ich muss mich selbst kennenlernen. Wenn alles zu viel wird, muss ich erkennen: Was stresst mich ganz konkret? Welche Störung genau, vielleicht ist es zu laut, wenn ich lerne. Ein Student aus einer Großfamilie war angestrengt, weil häufig ein Geschwisterkind reinkam, manchmal ist es in einer WG zu unruhig, dann hilft es, sein Setting zu verlassen und die Bibliothek aufzusuchen. Es kann auch helfen, Tagebuch zu schreiben, Dinge aufzuschreiben, da kommt mein Gehirn in einen Reflexionszustand.
Dringend geboten, so sagen Sie, sei die persönliche Definition von Erfolg. Was meinen Sie damit?
Spreche ich über Erfolge, merke ich, viele hadern mit dem Begriff und bringen ihn sofort mit sehr guten Leistungen und Noten in Verbindung. Ich definiere das anders. Ein Erfolg kann genauso bedeuten, als Erster in der Familie ein Studium anzustreben oder sich in unserer akademisierten Welt gegen ein Studium zu entscheiden, weil eine Ausbildung besser zu mir passt, oder sich um seine mentale und körperliche Gesundheit zu kümmern. Es ist superwichtig, sich mit sich selbst zu beschäftigen und nicht so viel über andere nachdenken.
Bei jungen Leuten liegt der Gedanke an Gesundheit nicht nah.
Sollte er aber. Chronische Krankheiten nehmen zu, von Allergien bis hin zu Rückenschmerzen, davon sind bereits 40 Prozent ab 16 Jahren betroffen. Ich sage dann, achte auf deine Gesundheit, du hast nur die eine, und es ist okay, wenn du nicht so durchpowerst, große Pläne hast und immer weiter Leistung bringen willst.
So ein offener Ansatz dürfte den meisten jungen Menschen wenig attraktiv erscheinen.
Leider ist das so. Viele meinen, sie dürften keinen Karriereknick riskieren. Studierende denken, zu scheitern und Fehler zu machen, sei nicht erlaubt. Häufig wird Karriere mit viel Geld verknüpft. Sich die Frage zu stellen, was einen wirklich beruflich erfüllt und wo man sich in fünf Jahren sieht, bringt weiter. Unter meinen Klienten jenseits der Hochschulen sind sehr viele Frauen, Anfang 30 bis Mitte 40, die ihre Stärken nicht kennen und noch nicht wissen, was sie beruflich erfüllt.
Wie erkenne ich denn, was mich beruflich erfüllen könnte?
Außer der Selbstreflexion kann ich mir Zeit für echten Austausch mit anderen nehmen. Ich kann Familie und Freunde fragen: Was findet ihr gut an mir? Worüber unterhältst du dich gerne mit mir? So erhalte ich ein umfassenderes Bild. Wir sehen uns immer so, wie wir denken, dass uns andere sehen. Und natürlich erkennen, welche Werte einem wirklich wichtig im Leben sind, dann weiß ich, wie ich mich beruflich ausrichten soll.
Lässt sich Selbstvertrauen wirklich üben?
Absolut. Unser Selbstwert ist zu 50 Prozent genetisch bedingt, die restlichen 50 Prozent sind erlern- und veränderbar. Vier Quellen definieren, woraus man Selbstvertrauen schöpfen und erhöhen kann: Erstens sind das Erfolgserlebnisse: Was kann ich richtig gut, was habe ich geschafft? Vorausgesetzt, das schreibe ich meinen eigenen Fähigkeiten zu und sage nicht, das Niveau war niedrig, die Klausur war leicht. Zweitens kann ich von Vorbildern lernen, von Menschen, die mir sympathisch sind. Das mache ich zum Beispiel in Gießen und matche jüngere und ältere Studierende, diese Zweierteams lernen voneinander.
Zuspruch von anderen ist entscheidend fürs gute Selbstbild?
Das ist der dritte Aspekt, Feedback und verbale Unterstützung von anderen einzuholen. Aber nicht nur zu hören: Stell dich nicht so an, du schaffst es! Das muss konstruktiv und konkret sein. Das kostet Überwindung, weil ich mich verletzlich mache. Der vierte Punkt ist der schwierigste, das ist das Thema Gefühle, ich brauche die Fähigkeit, Emotionen zu verarbeiten.
Wie gelingt das denn, wenn ich mir wenig zutraue?
Gefühle zu regulieren lässt sich trainieren. Wenn ich sehr ängstlich oder sehr wütend bin, kann ich nicht klar denken. Salopp gesagt, je mehr gute Gefühle ich erlebe, desto besser kann ich andere Emotionen verarbeiten. Ich sage den Studierenden: Geht auf die Jagd nach guten Gefühlen. Das ist eine der am besten erforschten Übungen der Positiven Psychologie, sich zu vergegenwärtigen, was gut war am Tag. So lässt sich Glücksempfinden zurückholen und Genuss lernen.
Das Videofeedback in Ihren Seminaren knüpft daran an.
Anfangs empfinden das die Studierenden als schwierigste Aufgabe, sie sollen eine kleine Videopräsentation machen und erhalten dafür wohlwollendes Feedback. Während sie sich so empfinden, als zappelten sie vorne rum, sagen andere, das unterstreicht deine Leidenschaft, wie du über Dinge sprichst. So kann ich ein positives Mindset entwickeln.
Da bin ich skeptisch, das ist doch eine künstliche Situation?
Die Denkweise ist entscheidend. Habe ich ein starres, eingefahrenes Denken, dann beschränke ich mich selber, weil ich unter meinen Möglichkeiten bleibe. Dem gegenüber steht das Wachstumsdenken, Fähigkeiten kann ich erwerben, kann Intelligenz trainieren, das Gehirn ist ein Muskel: Ich kann das einüben vom Ich-kann-das-nicht-Gedanken hin zum Ich-kann-das-noch-nicht-Gedanken. Es ist förderlich, optimistisch in die Zukunft zu schauen und negative Glaubenssätze zu identifizieren, die mich einschränken.
Sie meinen Sätze wie: Sei stark, beeile dich.
Ja, ich kann zum Beispiel überlegen, was steckt für eine Kraft hinter der Aufforderung: Streng dich an. Dahinter steckt viel Energie, hohe Einsatzbereitschaft. Nun geht es darum zu überlegen, wie kann ich Kraft für mich persönlich einsetzen. Ich darf auch Spaß bei der Arbeit haben, ich darf kleine Schritte machen. Anstatt es allen recht zu machen, kann ich mir erlauben, mal Nein zu sagen, Grenzen zu ziehen und sie nicht überschreiten zu lassen.
Empathie lässt sich also leicht übertreiben?
Dazu neigen Menschen mit Selbstzweifeln, statt auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten. Das lässt sich aber lernen, sich die eigenen Wünsche zu erlauben. Es ist ein Prozess: Ist meine innere Stimme nun wohlwollend, und ermutigt sie mich, oder macht sie mich fertig und putzt mich herunter?
Was tun Sie, wenn jemand richtig depressiv ist?
Habe ich zwei Wochen lang einen extremen Überforderungsgedanken, dann rate ich ernsthaft, sich professionelle Unterstützung zu holen. Es ist eine wichtige Entwicklung, dass es inzwischen an vielen Hochschulen psychologische Beratungsangebote gibt. Trotzdem ist das für Betroffene eine Hürde und leider noch ein Tabuthema.
Alle Rechte vorbehalten. Copyright Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.





![Eine Hand hält eine Geldmünze über einer Geldbörse [© Porechenskaya – stock.adobe.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Symbolbilder/_card/3222189/Muenze-Geldboerse-Kapital.jpg)




