Lehre an Universitäten: Ist die Präsenzvorlesung noch zeitgemäß?
- Valentin Graepler
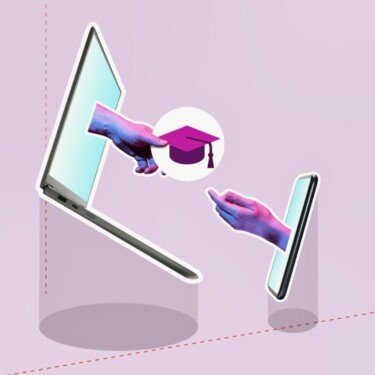
AdobeStock_441015926
Sie ist noch immer das gängigste Lehrformat - und wirkt auf viele überholt. Warum die Präsenzvorlesung trotz Kritik wertvoll bleibt, wie man das Beste aus ihr herausholt und welche Alternativen es gibt.
e‑fellows.net präsentiert: Das Beste aus der F.A.Z.
Lies bei uns ausgewählte Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und von FAZ.NET.
Nachmittags im Hörsaal. Die Studenten schleppen sich auf ihre Plätze, im Kopf nur noch Brei, die Aufnahmefähigkeit längst erschöpft. Vorne spricht der Professor - aber worüber eigentlich? So genau weiß das keiner. Manche scrollen gelangweilt am Handy, andere stützen den Kopf auf den Klapptisch und dösen. Dabei sollen Vorlesungen doch Wissen vermitteln. Und nicht bloß Zeit überbrücken.
Ist die Vorlesung noch eine zeitgemäße Form der Wissensvermittlung - oder hat sie längst ausgedient? Immerhin können Studenten heute mit wenigen Klicks komplexe mathematische Modelle erklärt bekommen, komplette Seminarreihen kostenlos ansehen und Hintergrundwissen in Sekundenschnelle abrufen. Das hat auch das Lernen selbst verändert: Viele erwarten, Inhalte im eigenen Tempo konsumieren zu können - mit Pausentaste, Rückspulfunktion und Temporegler. Statt sich in den Hörsaal aufzumachen, bleibt manch ein Student deshalb lieber unter der Bettdecke.
Die Pandemie hat die Hochschulen gezwungen, mehr zu digitalisieren. Lehrveranstaltungen wurden online übertragen oder vorab aufgezeichnet. Auf einmal stand "Vorlesung anhören" nicht mehr im Widerspruch zu "unter der Bettdecke eingekuschelt sein". Das Ergebnis der Covid-Hochschulexperimente: zwiespältig. Asynchron abrufbare Formate ermöglichten es Studenten, schwierige Passagen zu wiederholen und Inhalte ihrem Tagesrhythmus anzupassen. Gleichzeitig waren viele Livestreams noch ermüdender und weniger interaktiv als Präsenzvorlesungen.
"Wir überlegen, auf traditionelle Vorlesungen weitgehend zu verzichten"
Vor Youtube-Videos, Google-Suche und KI-Chatbots war Wissen nicht einfach so verfügbar. Natürlich gab es Bücher - aber die waren lange Zeit selten und für viele unerschwinglich. Wer lernen wollte, musste dorthin gehen, wo Wissen mündlich vermittelt wurde: an die Universität. Die Vorlesung war eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt Zugang zu akademischem Wissen zu erhalten. Im 11. Jahrhundert entstanden in Städten wie Bologna und Oxford die ersten Hochschulen. Sie waren in erster Linie Lehranstalten - Forschung spielte damals kaum eine Rolle. Die Wissensvermittlung funktionierte nach einem simplen Prinzip: Professoren lasen vor, die (männlichen) Studenten hörten zu.
Auch als Wilhelm von Humboldt im 19. Jahrhundert das forschende Lernen zum Ideal erklärte, blieb die Vorlesung das Herzstück der Universität. Seminare kamen hinzu, doch bis heute ist das Frontalformat aus den meisten Fächern nicht wegzudenken - insbesondere in Massenstudiengängen wie Jura, BWL oder Medizin. Eine Universität ganz ohne Vorlesungen? Für viele undenkbar.
Und doch gibt es nun eine Universität, die das scheinbar Undenkbare denkt. An der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder erwägt man, sich von der klassischen Vorlesung weitgehend zu verabschieden. Uni-Präsident Eduard Mühle erklärte der F.A.Z.: "Wir überlegen, auf traditionelle Vorlesungen weitgehend zu verzichten, da uns Frontalunterricht nicht mehr zeitgemäß erscheint." Er bezieht sich dabei auf das "verfassungsmäßige Recht der Lehrenden auf Freiheit in der Lehre".
Die Viadrina erwägt diesen Schritt wohl auch wegen ihrer besonderen Lage: sinkende Studentenzahlen und zahlreiche Pendler aus Berlin. Einer von ihnen war Justin, der dort Kulturwissenschaften studiert hat. "Die Uni ist stark auf Berliner Studenten eingestellt - man kann sich die Kurse so legen, dass man nur zwei bis drei Tage pro Woche vor Ort ist", sagt er. Trotzdem sei im Zug ein Stück Campus-Gefühl entstanden. Justin ist sich unsicher, ob man ganz auf Vorlesungen verzichten sollte: "Gerade für den Einstieg sind sie enorm bereichernd, weil man schnell einen guten Überblick bekommt." Hybride und interaktivere Formate findet er dennoch zukunftsweisend.
"Die Vorlesung gilt vielen als veraltet, passiv und wirkungslos"
Tatsächlich zeigen mehrere Studien: Lernen erfolgt nachhaltiger durch aktive Beteiligung als durch reines Zuhören. Studenten wollen die Chancen nutzen, die die Digitalisierung bietet. Eine Untersuchung der Universität Ulm ergab: Digitalisierte Formate, die zur aktiven Teilnahme anregen, steigern nicht nur die Zufriedenheit, sondern führen auch zu besseren Prüfungsergebnissen. Und eine Studie der University of California kam zu dem Schluss, dass schneller abgespielte Online-Vorlesungen das Verständnis kaum beeinträchtigen. Wer so besser lernen kann, macht also nichts falsch.
"Die Vorlesung gilt vielen als veraltet, passiv und wirkungslos", sagt Gabi Reinmann, Hochschuldidaktikerin an der Universität Hamburg. Diese Kritik sei nicht unbegründet - viele Dozenten hätten nie gelernt, eine Vorlesung kognitiv anregend und interaktiv zu gestalten. "Uninspirierte Power-Point-Vorträge sind die Folge." Doch daraus zu schließen, das Format sei überflüssig, hält sie für einen Fehlschluss. Denn: "In Vorlesungen können Lehrpersonen ihr Fach authentisch als Forscherpersönlichkeit präsentieren und Studierende für die Wissenschaft begeistern." Vorlesungen ermöglichen Einblicke in die Denkweise der Lehrenden und schaffen persönliche Nähe - etwas, das digital nur begrenzt gelingt.
Befürworter merken zudem an: Nicht die Vorlesung sei langweilig, sondern die Studenten überreizt. Eine gut gemachte Vorlesung könne einen festen, ungestörten Zeitrahmen schaffen, in dem Konzentration möglich ist. Ähnlich sieht es Reinmann. "Eine Präsenzvorlesung kann sozialer Taktgeber sein und Orientierung bieten." Sie warnt aber auch: Zu oft werde das Format vor allem in großen Studiengängen zur Massenabfertigung genutzt. Ihre Forderung: "Didaktisch kompetent gestaltete Vorlesungen, die dosiert angeboten und sinnvoll mit anderen Lehrformaten verknüpft sind."
Neunzigminütige Frontalvorlesung bleibt vorerst Teil des Studienalltags
Welche Alternativen gibt es zur Vorlesung bis auf das klassische Seminar? Die Viadrina setzt verstärkt auf kleinere Kurse, Blockveranstaltungen und Inverted-Classroom-Formate. Hier eignen sich Studenten die Inhalte vorab selbst an und nutzen die Präsenzzeit für Diskussionen und vertiefende Übungen. Weitere Konzepte sind das sogenannte Peer Learning sowie Learning Communities: Beim Peer Learning lernen Studenten voneinander, indem sie sich Inhalte gegenseitig erklären. Learning Communities hingegen sind feste Gruppen, die sich über längere Zeit hinweg austauschen und unterstützen. Die vielen englischen Begriffe sind kein Zufall - im angelsächsischen Raum setzt man schon lange verstärkt auf partizipativere Lehrformen. Für alle drei Ansätze gilt: Aktives, gemeinsames Lernen soll den einseitigen Frontalvortrag ersetzen.
Wie auch immer man zu ihr steht - an den meisten Universitäten bleibt die neunzigminütige Frontalvorlesung vorerst Teil des Studienalltags. Wer trotzdem das Beste aus ihr herausholen will, kann der Eintönigkeit mit aktiver Teilnahme etwas entgegensetzen. Das beginnt schon vor der Veranstaltung: Ein kurzer Blick in den Lehrplan hilft, sich auf das Thema vorzubereiten. Auch eine kurze Recherche oder das Durchsehen alter Folien und eigener Notizen kann helfen, den roten Faden zu erkennen.
Während der Vorlesung ist es sinnvoll, mit Notizen zu arbeiten - präzise und auf das Wesentliche konzentriert. Wer versucht, alles wortwörtlich mitzuschreiben, verliert leicht den Überblick. Unklare Punkte sollte man notieren, um sie später nachzufragen oder selbst nachzulesen. Und auch wenn man gerade nicht mitschreibt: aufmerksam bleiben. Wenn der Laptop mehr ablenkt als nützt, lieber zuklappen und zuhören.
Nach der Vorlesung lohnt es sich, die eigenen Notizen noch einmal durchzugehen. Wer mit anderen über die Inhalte spricht und sich zu den behandelten Themen abfragt, kann das Wissen festigen und Lücken schließen. Dann wird aus der müden Pflichtstunde eine produktive Lernzeit.
Alle Rechte vorbehalten. Copyright Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.





![Eine Hand hält eine Geldmünze über einer Geldbörse [© Porechenskaya – stock.adobe.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Symbolbilder/_card/3222189/Muenze-Geldboerse-Kapital.jpg)




