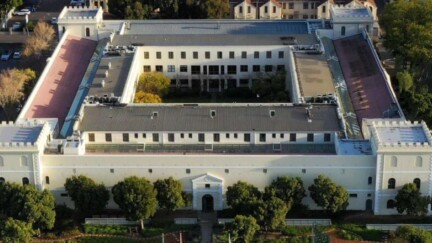Weiterführendes Studium: Wissenswertes zum Master

Lustre – stock.adobe.com
Master-Studiengänge bei e‑fellows.net
Master-Studium im Überblick
Ein Master-Studium ist der zweite berufsqualifizierende Hochschulabschluss nach dem Bachelor. Während du im Bachelor-Studium die Grundlagen deines Faches lernst, werden dir im konsekutiven Master Detail- und Hintergrundwissen vermittelt, das auf bisher Gelerntem aufbaut oder dieses fächerübergreifend erweitert. Du kannst aber auch eine neue Richtung einschlagen, indem du einen weiterbildenden Master-Studiengang wählst. So kannst du zum Beispiel deinen Bachelor in Bauingenieurwesen mit einem Master in Management ergänzen und dich damit für eine Führungslaufbahn qualifizieren. Nach deinem Master-Studium kannst du entweder ins Berufsleben einsteigen oder eine Promotion anstreben.
Wie lange dauert ein Master-Studium?
In der Regel dauert ein Master in Deutschland vier Semester, also zwei Jahre. Master-Studiengänge werden in Deutschland von Universitäten und Fachhochschulen angeboten. Insgesamt gibt es über 9.500 weiterführende Studiengänge. Um den Abschluss zu erhalten, musst du Leistungen im Wert von 120 ECTS-Punkten bzw. 90 ECTS (eineinhalb Jahre) erbringen. Ein Master im Ausland dauert bisweilen nur zwei Semester und umfasst 60 ECTS-Punkte. Neben der Vollzeit-Variante wird der Master häufig auch in berufsbegleitenden Studienmodellen angeboten.
Achtung: Wenn du promovieren willst, musst du insgesamt 300 ECTS-Punkte aus Bachelor- und Master-Studium nachweisen. Mit einem Bachelor, der sechs Semester dauert, und einem Master, der zwei Semester dauert, erfüllst du diese Voraussetzung in der Regel nicht.
Master – diese Abschlüsse gibt es
Master of Science (M.Sc.)
Wenn du eine Naturwissenschaft wie Physik, Chemie oder Biologie studierst, verleiht dir deine Hochschule in der Regel einen Master of Science.
Master of Arts (M.A.)
Mit einem Studium der Wirtschaft, der Medien, der Kultur, des Sozialen oder anderen Geisteswissenschaften erhälst du einen Master of Arts.
Master of Engineering (M.Eng.)
Die oft praxisorientierten Master of Engineering erhältst du für dein Studium der Ingenieurwissenschaften, wie Elektrotechnik, Maschinenbau oder Mechatronik.
Master of Business Administration (MBA)
Der Master of Business Administration steht meistens Studierenden aller Bachelor-Studiengänge offen. Der MBA dient überwiegend als Ergänzung bzw. Weiterbildung in den Bereichen Wirtschaft, Management und Führung. Ein MBA gilt als Türöffner für die Führungsetagen. Viele MBA-Programme haben eine Spezialisierung, bspw. auf Führung oder Human Resources.
weitere Master-Abschlüsse
- Absolvent:innen des Master of Laws (LL.M.) sind vor allem auf dem internationalen Parkett des Rechts bewandert. Neben der freiberuflichen Tätigkeit steht ihnen auch eine Karriere als Wirtschaftsjurist:in offen.
- Master of Education (M.Ed.) – eine Alternative zum Lehramt. Nach dem Abschluss bist du in der Regel für das Referendariat qualifiziert. Du bekommst hier sowohl fachliche- als auch pädagogische Kompetenzen vermittelt.
- Der Master of Fine Arts (M.F.A.) fördert deine künstlerische Ader. Nach dem Abschluss bist entweder als selbstständige:r Künstler:in tätig, oder arbeitest angestellt in Museen oder Theatern.
- Mit dem Master of Music (M.Mus.) kannst du deine Leidenschaft für Musik zum Beruf machen und dein Wissen aus dem Bachelor vertiefen. Neben einer Solo- oder Ensemble-Karriere kannst du auch musikpädagogische Aufgaben übernehmen.
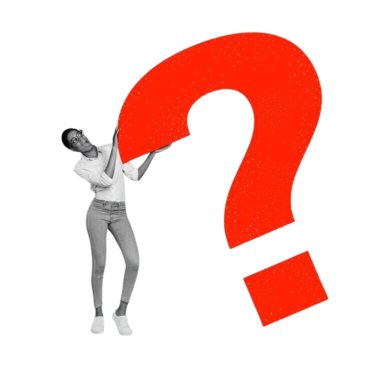
Alle Master in Deutschland …
… findest du bei e-fellows.net nicht. Wir präsentieren dir Master- und MBA-Programme ausgewählter Universitäten, Fachhochschulen und Business Schools. Find heraus, ob das passende Studium für deine Pläne dabei ist: Möchtest du durch den Master mehr Geld verdienen? Versprichst du dir bessere Jobangebote in Unternehmen oder möchtest du mit dem Studium die optimale Vorbereitung auf deine Promotion erreichen? Egal, was deine Beweggründe für ein Master-Studium ist – ein Blick auf die nachfolgenden Programme lohnt sich allemal. Und vielleicht hast du auch schon bald deinen Studienplatz sicher?
Jetzt Master-Stipendien finden
Master-Studiengang finden mit Plan
Für die Suche nach dem passenden Master-Studiengang solltest du dir Zeit nehmen. Du hast viele Möglichkeiten, die du kennen und richtig nutzen solltest. Zuerst ist es wichtig, dir zu überlegen, ob du in einem konsekutiven oder nicht-konsekutiven Master studieren möchtest. Hast du dich für die grobe Richtung deiner weiteren Hochschulausbildung entschieden, kannst du dich auf die Suche nach einem passenden Master-Studiengang machen. Außerdem musst du dir Gedanken darüber machen, ob du die Hochschule oder Studienstadt wechseln möchtest.
Natürlich kannst du die Website jeder einzelnen Hochschule ansteuern, um dich über ihre Programme zu informieren, oder Termine mit der Studienberatung vereinbaren. Einfacher geht es mit Studiengangsdatenbanken und Infoportalen. Auch e-fellows.net stellt dir verschiedene renommierte Master-Programme vor, die du bei deiner Entscheidung nicht vergessen solltest. Auf Infoveranstaltungen und Messen, wie den e-fellows.net Master Days, kannst du mit Vertretern deiner präferierten Studiengänge über deine Optionen sprechen. Oft triffst du dabei auch Absolvent:innen der Hochschulen, die dir aus erster Hand von ihren Erfahrungen berichten können.
Master-Bewerbung – aber richtig
Deine Bewerbung um einen Studienplatz solltest du so früh wie möglich vorbereiten. Jede Hochschule setzt andere Bewerbungsfristen, über die du dich im Vorfeld informieren musst. Zudem gilt es, sich um verschiedene Unterlagen und Nachweise zu kümmern, die bei den Unis eingereicht werden müssen. Oftmals wird auch ein Motivationsschreiben verlangt oder gar ein Vorstellungsgespräch geführt. Für andere Studiengänge werden die Studenten durch einen schriftlichen Test ausgewählt. Umso wichtiger ist es, dich über die Zulassungsvoraussetzungen deiner Wunschhochschulen zu informieren – sonst verbaust du dir durch verpasste Fristen eventuell die Chance auf deinen Traumstudiengang.