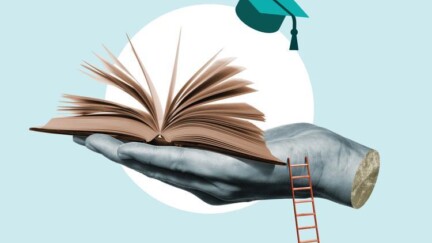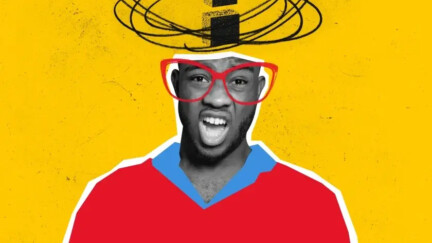Studium: Tipps & Techniken für mehr Erfolg an der Uni

Lustre – stock.adobe.com
Studienfinanzierung
Studiengänge
Studienwahl
Tipps zum Studienstart
Auslandsstudium
Jobben als Student
Unistädte
Bachelor-Studium
Duales Studium
Master-Studium
MBA-Studium
LL.M.-Studium
Promotion
Executive-Education-Programme
Erfahrungsberichte
Studieninfos kompakt
Für viele Abiturienten in Deutschland ist das Studium der logische Schritt nach dem Schulabschluss: Im Jahr 2022 lag die Studienanfängerquote bei 55 Prozent. Im Wintersemester 2022/23 waren rund 2,9 Millionen Studenten an deutschen Hochschulen eingeschrieben.
Gap Year vor dem Studieren: Au-Pair, Work and Travel oder FSJ
Auch wenn sich viele Abiturienten für ein Studium entscheiden, tun längst nicht alle diesen Schritt sofort. Der Grund dafür ist einfach: Geht es erst einmal mit der Uni los, stehen in den Semesterferien Klausuren, Seminararbeiten oder Praktika an. Für eine längere Auszeit ist wenig Platz. Deshalb legen viele Abiturienten ein Gap Year ein, in dem sie ins Ausland gehen (Work and Travel), als Au-Pair arbeiten oder ein freiwilliges soziales Jahr machen. Bei e-fellows.net erfährst du, welche Voraussetzungen du für die Programme erfüllen musst, wie man einen solchen Aufenthalt plant und wie du ihn finanzieren kannst.
Das richtige Studium wählen
Wer schon seit der Grundschule Tierarzt oder Architekt werden will, hat es bei der Studienwahl natürlich leichter als jemand, der noch keine konkreten Zukunftspläne hat. Um das passende Studienfach zu finden, solltest du dir über deine Interessen ebenso klar werden wie über deine Erwartung an einen Beruf. Worin bist du gut? Was macht dir Spaß? Kannst du dir vorstellen, dich 40 Stunden pro Woche damit zu beschäftigen? Selbsttests für die Studienwahl können dir eine erste Einschätzung geben. Hilfreich ist es auch, sich mit älteren Studenten über ihre Erfahrung auszutauschen – zum Beispiel beim Studien-Infotag "Startschuss Abi" – oder eine Vorlesung im Wunschfach zu besuchen.
Die Entscheidung, wo du studieren wirst, hängt natürlich davon ab, wo dein Wunschfach angeboten wird. Wenn mehrere Unis zur Auswahl stehen, lohnt sich ein Besuch, um Stadt und Hochschule kennenzulernen. Schließlich willst du nicht die nächsten Jahre an einem Ort verbringen, den du nicht leiden kannst. Hier stellen dir e-fellows ihre Uni-Städte vor – von A wie Aachen bis Z wie Zürich.
Die Hürde vor der Uni: Der Numerus Clausus
Hast du dein Studienfach gefunden, stellt sich die Frage: Erfüllst du die Voraussetzung? Viele Universitäten in Deutschland vergeben Studienplätze anhand des Numerus Clausus, kurz NC. Sie lassen also nur Studenten zu, die einen bestimmten Mindestdurchschnitt vorweisen können. Wer diesen Notendurchschnitt nicht hat, muss sich eine Uni mit niedrigerem NC suchen, auf das Losverfahren vertrauen oder Wartesemester sammeln. Daher lohnt es sich, auch verwandte Fächer zu berücksichtigen oder sich im Ausland umzuschauen.
Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Student sein
Die Erstsemester-Einführungen liegen hinter dir, der Start an der Uni ist geglückt. Doch schon stehen neue Fragen an – zum Beispiel: Wie geht wissenschaftliches Arbeiten? Wo kannst du als Student Geld sparen? Mit welchen Lerntechniken bereitest du dich effizient auf Klausuren vor? Und wie findest du Motivation, wenn der Druck zu groß wird? In der e-fellows.net community bekommst du die Antworten.
Studieren im Ausland
Laut dem Statistischen Bundesamt haben zuletzt fast etwa 140.000 Deutsche im Ausland studiert. Die beliebtesten Länder sind Österreich, Niederlande, Großbritannien, die Schweiz, die USA und China. Besonders häufig gehen Studenten in den Fächern Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen ins Ausland. In Liechtenstein studieren überdurchschnittlich viele Deutsche Wirtschaftswissenschaften. Wir geben dir Tipps zur Organisation und Finanzierung deines Auslandsaufenthalts und stellen verschiedene Länder vor.
Das Studium finanzieren
Studieren schön und gut – aber wer bezahlt dafür? Na, zum Beispiel der Staat: Wenn du BAföG beantragst, erhältst du monatlich bis zu 861 Euro. Einen Haken hat die Sache aber: BAföG bekommt nur, wer bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Zum Beispiel dürfen deine Eltern nicht zu viel verdienen. Der BAföG-Rechner von e-fellows.net sagt dir, wie deine Chancen stehen. Eine Alternative zum BAföG stellen Studienkredite dar. Sie bieten günstigere Konditionen als gewöhnliche Kredite, zum Beispiel niedrigere Zinssätze.
Die beste Option zur Studienfinanzierung sind Stipendien. Leider schrecken viele Studenten vor einer Bewerbung zurück, weil sie sich nicht für geeignet halten. Doch Top-Noten sind nicht das einzige Kriterium, das bei der Stipendiatenauswahl eine Rolle spielt. Umfangreiche Infos zu Stipendien (zum Beispiel zu den Begabtenförderungswerken oder zum Deutschlandstipendium) findest du in unserer Stipendien-Rubrik. In der Stipendien-Datenbank findest du das passende Stipendium für dich.