

Karriere & Einstieg: Freshfields
Freshfields ist eine weltweit tätige Anwaltssozietät mit Mandanten aus der Finanzbranche und Industrie. Erfahr hier mehr über deine Karrieremöglichkeiten.
- Branche
- Rechtsberatung
- Beschäftigte in Deutschland
- 2.100
- Standorte in Deutschland
- 5
- Hauptsitz
- London
Freshfields im Überblick
Was macht Freshfields?
Freshfields ist eine globale Anwaltssozietät. Die Kanzlei unterstützt seit langem erfolgreich die führenden Industrie- und Finanzunternehmen, Institutionen und Regierungen bei ihren komplexen Projekten, Transaktionen und Herausforderungen.
Ob aus den 29 Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit oder mit führenden Kanzleien vor Ort – die mehr als 2.800 Anwältinnen und Anwälte beraten wirtschaftsrechtlich umfassend und bündeln ihre Kompetenz zu entscheidenden Rechts- und Branchenlösungen für alle Mandanten.
Succeed together means to me for my personal and work life that as an individual you can be good but as a team you are better.
Aktuelles von Freshfields gibt's auf Instagram
Einstiegsmöglichkeiten bei Freshfields
Praktikum
Im fünfwöchigen Praktikumsprogramm »Smart Challenge« blickst du den Anwält:innen bei ihren Aufgaben über die Schulter und bist fest in die Teamarbeit eingebunden. Du nimmst an Verhandlungen teil, arbeitest an Schriftsätzen und Beratungsschreiben mit und unterstützt bei der Erstellung von Publikationen und Gutachten. Für eine optimale Betreuung stellt dir Freshfields eine Anwältin oder einen Anwalt für das persönliche Mentoring zur Seite. Interessante Vorträge runden den fachlichen Teil deiner Praxiserfahrung in der Kanzlei ab.
Doch auch die soziale Komponente kommt nicht zu kurz: Durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm erhältst du ausreichend Gelegenheit, dich mit den Praktikant:innen der anderen Standorte auszutauschen.
Referendariat
Als Referendar:in in der Anwalts- oder Wahlstation findest du am besten heraus, wie bei Freshfields gearbeitet wird. Während deines Referendariats nimmst du an einem maßgeschneiderten Weiterbildungsprogramm teil, dem Freshfields College.
Es bietet einen Einblick in den Arbeitsalltag bei Freshfields, ein umfangreiches Kursangebot für deine fachliche und persönliche Entwicklung sowie die Möglichkeit zum Netzwerken mit den Partner:innen und Associates.
Direkteinstieg
Als Associate bei Freshfields startest du deine Karriere als vollwertiges Mitglied eines hochqualifizierten Teams. Du arbeitest an anspruchsvollen Mandaten und stellst dich täglich neuen Herausforderungen. Mit anderen Worten: Bei Freshfields findest du die optimalen Voraussetzungen, um rasch zu einer herausragenden Anwaltspersönlichkeit zu reifen. Du hast die Wahl zwischen den Hauptstandorten Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München.
Als Litigator in Freshfields' neuer Einheit der Konfliktlösungspraxis (MCU) wirst du Teil eines spannenden und hochspezialisierten Teams für Prozessführung in Massenklageverfahren. Du kannst an den Standorten Münster, Hannover und Nürnberg einsteigen.
Auf deinem Weg dorthin legt Freshfields sehr großen Wert darauf, deine Entwicklung aktiv zu fördern und dir ein Umfeld zu bieten, in dem du dich wohlfühlst. Dabei achtet die Kanzlei auf ein umfangreiches Weiterbildungsangebot, flexible Arbeitsmodelle und die Möglichkeit von Teil- und Auszeiten.
Offene Stellen bei Freshfields
Wie kannst du dich bei Freshfields bewerben?
- Bewirb dich online direkt am Standort und der Praxisgruppe deiner Wahl mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Abitur- und Staatsexamenszeugnisse, Stationszeugnisse, weiteren Qualifikationen, etc.).
- Geeignete Kandidat:innen werden zu einer eintägigen Bewerbungsrunde im Büro und der Praxisgruppe ihrer Wahl eingeladen. Dort führst du eine Reihe von Interviews mit Partner:innen und Associates unterschiedlicher Senioritätsstufen. Du bekommst die Möglichkeit, deine potenziellen Kolleg:innen kennenzulernen, deine Fragen (Aufgabenspektrum, typischer Arbeitstag etc.) loszuwerden und gemeinsam herauszufinden, ob es auf beiden Seiten passt. Dieser strukturierte Interviewtag beinhaltet eine Ansprechperson, die zwischendurch für Fragen zur Verfügung steht und dich durch den Tag begleitet.
- Sollte es für Freshfields oder dich von besonderem Interesse sein, einen zweiten Standort zu besuchen, kann dies der letzte Schritt vor der finalen Rückmeldung sein.
Karriere bei Freshfields: FAQ
Freut ihr euch über Initiativbewerbungen?
Zögere bitte nicht, Freshfields deine Initiativbewerbung für die unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten zuzuschicken – diese nimmt die Großkanzlei jederzeit sehr gerne entgegen. Das HR-Team steht hierbei für offene Fragen stets zur Verfügung.
Welche Hierarchieebenen erwarten mich?
Als Berufseinsteigerin oder Berufseinsteiger beginnst du als Associate. Du arbeitest von Anfang an eigenständig und eng mit deinem Team zusammen. Hast du dabei über die Zeit hinweg herausragende fachliche und persönliche Kompetenz bewiesen, ist die Ernennung zum Principal Associate der nächste Schritt. Darauf aufbauend ist dann ein Counsel-Status oder die spätere Entscheidung zur Aufnahme in die Partnerschaft möglich.
Im Ausland arbeiten war schon immer mein Traum. Kann ich ihn bei euch verwirklichen?
Da Freshfields eine internationale Großkanzlei ist, ist es auf jeden Fall möglich, Erfahrungen im Ausland zu sammeln und damit ein fester Bestandteil im Arbeitsalltag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
So sind die Teams büro- und länderübergreifend eng miteinander verzahnt und stehen dabei in regem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, um gemeinsam an globalen Mandaten zu arbeiten – Internationalität wird bei Freshfields aktiv gelebt! Außerdem ermöglicht die Großkanzlei ihren Associates auch regelmäßig mehrmonatige Secondments an verschiedenen Standorten, zum Beispiel in Brüssel, London, New York oder Hongkong. Auch das Angebot für einen kurzen Auslandsaufenthalt, im Rahmen eines sogenannten Mini Secondments, wird vielfältig von den Associates genutzt.
Doch auch schon als Stationsreferendarin oder -referendar besteht die Möglichkeit, die Wahlstation in einem der internationalen Büros zu absolvieren, falls du bereits zuvor bei Frehsfields tätig warst. Im Rahmen des Praktikantenprogramms ist außerdem ein Praktikum im Brüsseler Büro möglich.
Ich brauche eine Auszeit. Kann ich bei euch ein Sabbatical machen?
Jeder braucht ab und zu eine Pause – eine selbstgewählte Auszeit in Form eines Sabbaticals ist ab dem Principal Associate Level möglich. Und keine Sorge: Selbstverständlich ist sichergestellt, dass nach einer Auszeit die Karriereentwicklung wie geplant weitergeht.
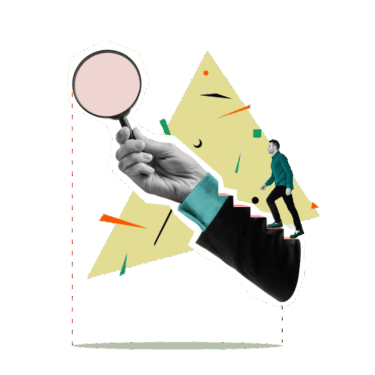
Was bietet Freshfields?
Von Arbeitsumfeld bis Benefits: Erfahr, was dich als Mitarbeiter:in bei Freshfields erwartet.
Vielfältiges Arbeitsumfeld
Weiterentwicklung
Aufstiegs-
möglichkeiten
Benefits

Auch als Partner nutze ich mobiles Arbeiten und wechsle vom Büro ins Homeoffice, etwa um abends mit meiner Familie zu essen.

Nach meiner Elternzeit haben wir gemeinsam das passende Arbeitszeitmodell für mich gefunden.
Die Praxisgruppen von Freshfields
In jeder der neun Praxisgruppen werden Berufsanfänger:innen Schritt für Schritt mit dem Fachbereich vertraut gemacht. Dabei arbeitest du eng mit Kolleg:innen aus der ganzen Welt an länderübergreifenden Projekten zusammen.
Die Arbeitsgebiete von Freshfields umfassen insbesondere:
- Arbeitsrecht
- Bank- und Finanzrecht
- Geistiges Eigentum und Informationstechnologie
- Gesellschaftsrecht/ M&A
- Immobilienwirtschaftsrecht
- Kartellrecht und Außenhandel
- Konfliktlösung
- Öffentliches Wirtschaftsrecht
- Steuerrecht
Weitere Informationen und Hinweise zu Einstiegsmöglichkeiten bei Freshfields erhältst du auf der Karriere-Website.









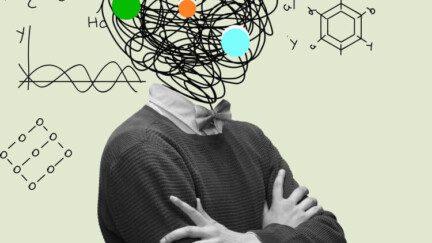















![Veranstaltung Networking [Quelle: e-fellows.net]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Bilder-fuer-Newsletter/Bilder-fuer-Events-keine-Symbolbilder/_card/Perspektive-Wirtschaftskanzlei-Collegium-2018_1280x720_full_image.jpg)