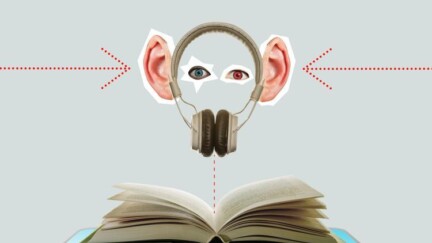Auslandssemester: "Ich dachte, ich werde den ganzen Tag Spanisch sprechen"
- Antonia Hotter
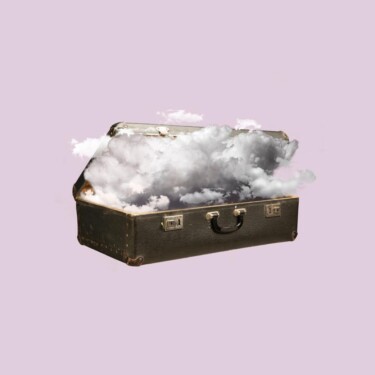
master1305 – stock.adobe.com
Was erwartet Studenten während eines Auslandssemesters? Nicht immer das, womit sie gerechnet haben. Wann es trotzdem der richtige Schritt ist – und wie viel Wert Arbeitgeber auf Auslandserfahrung legen.
e‑fellows.net präsentiert: Das Beste aus der F.A.Z.
Lies bei uns ausgewählte Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und von FAZ.NET.
Ein botanischer Garten mitten in der Wüste, eine Universität zwischen Dattelpalmen und Granatapfelbäumen: So beschreibt Moritz Taube den Ort, an dem er das vergangene Wintersemester verbracht hat. Almería, eine Stadt an der Südküste Spaniens, etwa genauso groß wie Rostock, wo Taube normalerweise Lehramt auf Geschichte und Spanisch studiert. Es war seine erste längere Auslandserfahrung.
Organisiert hat Taube sein Auslandssemester über Erasmus+, eine Initiative der Europäischen Union. Seit 1987 können Studenten über dieses Programm eine Zeit lang an Partnerhochschulen im europäischen Ausland studieren. Inzwischen ist ein Austausch sogar weltweit möglich. Wer einen Erasmus-Platz erhält, wird finanziell unterstützt. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach den Lebenshaltungskosten im Gastland. In Spanien bekam Taube 540 Euro im Monat, in Frankreich wären es 600 Euro gewesen. Doch was erwartet einen während eines Semesters fern der Heimat eigentlich?
Nicht immer das, womit man gerechnet hat. "Ich dachte, ich werde den ganzen Tag Spanisch sprechen, viel mit Einheimischen zu tun haben und am Ende fast als Muttersprachler zurückkommen", erzählt Taube. Seine Kurse belegte er überwiegend auf Spanisch, er saß mit spanischen Studenten in Hörsälen und Seminaren. Trotzdem gestaltete sich sein Vorhaben schwieriger als gedacht. "Ich bin schnell in Erasmus-Gruppen gelandet. Viele wollten gar nicht Spanisch lernen. Man wird in Strukturen gedrängt, die auf Englisch funktionieren", sagt er bedauernd. Am Ende habe er sein Spanisch verbessert, aber nicht so sehr, wie er sich anfangs erhofft hatte.
Das Studienfach aus einem neuen Blickwinkel kennenlernen
Auch wenn das Verbessern der Sprachkenntnisse hinter den Erwartungen blieb, sammelte Moritz Taube jede Menge Eindrücke und knüpfte neue Freundschaften. Mit dem Erasmus Student Network, das Austauschstudenten vernetzt und Ausflüge organisiert, erkundete er das Land. "Ich habe viel von Spanien gesehen, viel von der Kultur mitgenommen" - nicht nur von der spanischen Kultur, auch von der französischen, italienischen, litauischen, polnischen. Zwar hatte er weniger Kontakt zu Einheimischen, dafür umso mehr zu anderen Austauschstudenten. "Ich bin offener für andere Kulturen und für neue Menschen geworden", sagt der Lehramtsstudent.
Genau darin liegt für Stephan Geifes, Direktor der nationalen Agentur für Erasmus+-Hochschulzusammenarbeit, der demokratische Kern des Programms. Erasmus ermögliche Menschen in einem entscheidenden Lebensalter zu erfahren, was das Leben in Europa ausmacht: gemeinsame Werte und Begegnungen auf Augenhöhe. "Europa wird nicht nur mit Waffen verteidigt, sondern auch mit Werten", sagt Geifes. Diese Werte seien nichts Abstraktes, man müsse sie wie Vokabeln selbst lernen: "Erasmus ist ein Friedensprogramm."
Wer ein Semester im Ausland verbringt, lernt sein Studienfach aus einem neuen Blickwinkel kennen. Deutlich wurde das für Katharina Enser, Psychologie-Studentin an der Universität Würzburg, die ein Semester in Straßburg verbrachte. In Erinnerung blieb ihr ein Seminar, das sich mit dem Rorschachtest befasste – ein Verfahren, bei dem Probanden beschreiben, was sie in Tintenklecksen erkennen. Daraus sollen Rückschlüsse auf die Persönlichkeit gezogen werden. "In Deutschland wird der Test eher kritisch gesehen, deshalb war es spannend, wie viel Raum er im französischen Curriculum bekam", erzählt Enser. Für sie war das eine Gelegenheit, die historische Entwicklung psychologischer Methoden besser zu verstehen und dabei die französische Fachsprache zu lernen. Auch das zeigt, worum es bei Erasmus geht: Neue Perspektiven gewinnen – oft dort, wo man es am wenigsten erwartet.
Fähigkeiten, die in Bewerbungsverfahren sehr gefragt sind
Viele Studenten entscheiden sich für ein Auslandssemester, um ihren Lebenslauf aufzuwerten. Doch wie wichtig ist Arbeitgebern Auslandserfahrung wirklich? Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) für den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) zeigt: Fast ein Drittel der Unternehmen hält einen Auslandsaufenthalt während des Studiums im Rekrutierungsprozess für "überhaupt nicht wichtig". Für Arbeitgeber zählt vor allem Praxiserfahrung, etwa in Form von Praktika oder Werkstudententätigkeiten. Danach folgen, in dieser Reihenfolge, außeruniversitäres Engagement, die Abschlussnote und die Studiendauer – erst dann der Auslandsaufenthalt.
Erschwerend kommt hinzu: Ein Semester im Ausland kann die Studienzeit verlängern, da sich an der Gastuniversität nicht immer passgenaue Kurse finden lassen. Was also tun: Auslandserfahrung sammeln oder das Studium zügig abschließen? 62,4 Prozent der vom IW befragten Unternehmen haben hier keine Präferenz. Von den übrigen sprachen sich die meisten für ein Auslandssemester aus. Nur 6,3 Prozent bevorzugen ausdrücklich eine eingehaltene Regelstudienzeit. Das klingt zunächst so, als spiele ein Auslandsaufenthalt für Arbeitgeber kaum eine Rolle. Doch die Studie stellt fest: Wer im Ausland studiert, entwickelt tendenziell Fähigkeiten, die in Bewerbungsverfahren sehr gefragt sind – darunter Selbständigkeit, Problemlösefähigkeit und Eigeninitiative. Ein Auslandssemester wirkt also, wenn auch manchmal auf Umwegen.
Personaler, die die F.A.Z. befragt hat, bestätigen den Mehrwert eines Auslandsaufenthalts für den Rekrutierungsprozess. Für Unternehmen wie BMW, Deloitte und die Deutsche Bank sind internationale Erfahrungen klare Pluspunkte. Lars Pfeiff, Personaler bei der Deutschen Bank, findet: "Oftmals sind es weniger greifbare Fähigkeiten oder Kenntnisse, sondern vielmehr eine zusätzliche Reife, die mit dieser Erfahrung einhergeht." Letztlich ist es ein Gesamtbild und ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, das entscheidet, ob sich ein Bewerber für eine Position qualifiziert.
Wie also entscheiden, ob ein Auslandssemester der richtige Schritt ist? Studienberater Tim Reichel empfiehlt, sich die Frage zu stellen: Warum will ich überhaupt ins Ausland? Viele Studenten, so seine Erfahrung, bewerben sich, weil sie denken, es müsse im Lebenslauf stehen – aus Sorge, dass es später komisch wirkt, wenn da keine Auslandserfahrung auftaucht. "Das ist einfach Quatsch", sagt Reichel. Es sei völlig in Ordnung, sich dagegen zu entscheiden. Man könne Auslandserfahrung durch Berufserfahrung und ein starkes, schnelles Studium in Deutschland ausgleichen. "Wer ins Ausland will, um Menschen, eine Sprache, die Kultur kennenzulernen – für den kann ein Auslandssemester ein riesiger Bonuspunkt sein." Wichtig sei dann nur: frühzeitig planen, sich klare Ziele setzen.
Ein Auslandssemester ist vor allem dann ein Gewinn, wenn man es nicht als Pflichtübung sieht, sondern als Chance begreift: eine Zeit, in der man bewusst aus der eigenen Komfortzone heraustritt. So hat es auch Lehramtsstudent Moritz Taube gemacht. Er nahm sich vor, das Semester unter Dattelpalmen zum aufregendsten Semester seines Lebens zu machen: "Deshalb habe ich mich auf Neues eingelassen – auch dann, wenn ich lieber zu Hause geblieben wäre. Man muss über den eigenen Schatten springen. Wer das schafft, wird eine unvergessliche Zeit haben."
Alle Rechte vorbehalten. Copyright Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.