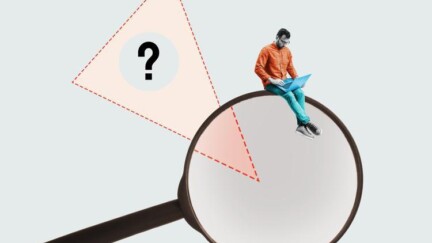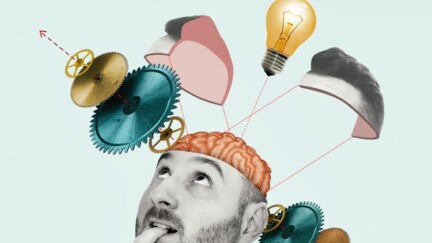Berufsbild Prüfer:in am Europäischen Patentamt: Die Suche nach dem Killerdokument
- Dr. Jörgen Jochheim und Dr. Andreas Werner
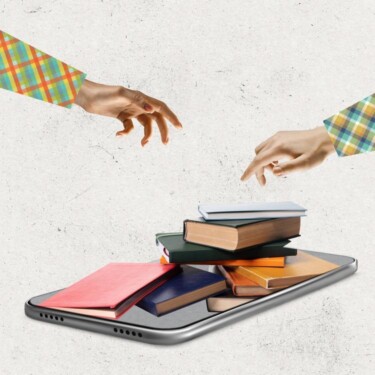
Lustre – stock.adobe.com
Ob Musikinstrumente oder Gentechnik: Für jedes Fachgebiet gibt es eine:n Prüfer:in am Europäischen Patentamt. Um zu beurteilen, ob eine Erfindung wirklich neu ist, muss er/sie in einer Unmenge von Daten nach einem möglichen "Killerdokument" suchen, das womöglich gegen eine Patentierung spricht.
Für Universitätsabsolvent:innen, die zwar juristisches Interesse mitbringen, jedoch nach langem Studium und eventueller Promotion nicht gleich einen weiteren Ausbildungsabschnitt zur Patentanwältin bzw. zum Patentanwalt anhängen möchten, könnte die Arbeit als Prüfer:in beim Europäischen Patentamt eine recht attraktive Alternative darstellen. Seit 1977 wird in Europa ein vereinheitlichtes zentrales Recherche- und Prüfungsverfahren für europäische Patentanmeldungen durchgeführt. Die dafür zuständige Behörde ist das Europäische Patentamt (EPA), eine weitgehend unabhängige internationale Organisation, die sich aus den von ihr eingenommenen Gebühren selbst trägt. Derzeit beschäftigt das Amt etwa 6.300 Bedienstete.
Für jedes Gebiet ein:e Expert:in
Am Standort München arbeiten etwa 2.800 Mitarbeiter:innen in einem modernen Bürokomplex auf dem Gelände der ehemaligen Pschorr-Brauerei; ein vergleichbar großes Zentrum befindet sich in Den Haag. Der weitaus größte Teil dieser Belegschaft beschäftigt sich als Patentprüfer:in mit der Recherche und Sachprüfung von Patentanträgen. Jede neu eingegangene Anmeldung wird zunächst von anderen Mitarbeitenden grob vorklassifiziert, auf formale Fehler und Vollständigkeit geprüft, und dann einer bzw. einem Prüfer:in zugeteilt, der/die sich mit einem eng umrissenen Themengebiet beschäftigt.
Für jedes noch so ungewöhnliche technische Gebiet muss es mindestens eine:n Spezialist:in geben, der/die eine neue Erfindung in diesem Bereich sachgerecht beurteilen kann – egal, ob es nun um Musikinstrumente, Turbolader, Gentechnik oder Joghurtbecher geht. Deshalb wird der/die Prüfer:in im Regelfall nur Anträge ganz bestimmter Patentklassen erhalten, in denen er durch seine vorherige Hochschulausbildung, berufliche Tätigkeit und Erfahrung besondere Expertise besitzt.
- Formale Voraussetzungen: abgeschlossenes Hochschulstudium entsprechend der jeweiligen Fachrichtung des/der Prüfer:in, Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaates, Beherrschen der drei Amtssprachen (Englisch, Französisch, Deutsch)
- Persönliche Qualifikation: Liebe zum Detail sowie zum Arbeiten in einem eng umrissenen gesetzlichen Rahmen
- Einstiegsgehalt: abhängig von der anrechenbaren Berufserfahrung
- Aufstiegsmöglichkeiten: zum Beispiel Mitglied in einer Beschwerdekammer, Wechsel ins Management
- Besonderheiten: Sonderstatus einer internationalen Organisation; das Gehalt unterliegt nicht der nationalen Einkommenssteuer; eigenes Sozialversicherungssystem
- Weitere Informationen: www.epo.org
Der/die Erstprüfer:in im Patentamt als Einzelkämpfer:in
Ein Patent kann für die Lösung eines technischen Problems erteilt werden, welche die drei Kriterien der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der industriellen Anwendbarkeit erfüllt und die obendrein ausreichend klar dargelegt sein muss. Eine Patenterteilung oder Zurückweisung muss am Ende immer von allen drei Kolleg:innen einer Prüfungsdivision unterschrieben werden. Der/die sogenannte "Erstprüfer:in" arbeitet zunächst im Alleingang. Dabei verbringt er/sie den größten Teil des Tages alleine mit Papieren und vor dem Computer, denn die Kommunikation mit dem/der Antragsteller:in oder dessen/deren Anwält:innen findet fast immer im Schriftverkehr statt.
Erst wenn es zur Klärung eines strittigen Sachverhalts unbedingt erforderlich ist, kann die Prüfungsdivision auch den/die Anmelder:in oder seinen Vertreter in das Amt einbestellen, um durch mündliche Verhandlungen im Prüfungs- oder Einspruchsverfahren zu einer Entscheidung zu gelangen. Schließlich werden unmittelbar vor einer Patenterteilung oder Zurückweisung zwei weitere Kolleg:innen hinzugezogen, die gemeinsam mit dem/der Erstprüfer:in die Entscheidung durch ihre Unterschrift bestätigen. Doch bis dahin ist es meist ein weiter Weg.
Die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen
Die Hauptarbeit gliedert sich in zwei Schritte, nämlich die Recherche nach dem Dokument, das der Anmeldung inhaltlich am nächsten kommt, und die anschließende Sachprüfung der Erfindung auf Patentierbarkeit. Zunächst muss der/die Prüfer:in das zugrunde liegende technische Problem und seine Lösung verstehen. Dies wird häufig dadurch erschwert, dass die Patentanmeldung in einer verklausulierten Fachsprache formuliert wird, die dem/der Anmelder:in einen möglichst großen Schutzumfang sichern soll und dementsprechend breit gefasst ist.
Ist der Kern der angemeldeten Erfindung zutage getreten, sucht der/die Prüfer:in in umfangreichen Datenbanken des EPA nach Dokumenten, die belegen könnten, dass die Idee zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits bekannt war. Die dafür zur Verfügung stehende Zeit ist begrenzt und erfordert eine effiziente Nutzung der spezifischen Informationsquellen eines jeden Fachgebiets – seien es technische Fachzeitschriften, Datenbanken für chemische Strukturformeln oder für Gensequenzen. Jedes Dokument, das auch nur einen Tag vor dem Anmeldedatum irgendwo auf der Welt der Öffentlichkeit zugänglich war, kann ein potenzielles "Killerdokument" sein, aber die Recherche danach gleicht oft der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.
Wie erfinderisch ist die Erfindung?
Ist ein solches Dokument schließlich gefunden worden, kann der/die Anmelder:in gezwungen werden, den beanspruchten Schutzumfang stark einzuschränken, oder die Patentanmeldung wird sogar ganz zurückgewiesen. Oft kommt es aber auch vor, dass nichts gefunden wird, was die Neuheit der Erfindung infrage stellen würde. In diesem Fall muss der/die Prüfer:in dennoch diejenigen Dokumente identifizieren und zitieren, welche dem Gegenstand der angemeldeten Erfindung inhaltlich am nächsten kommen. Das ist wichtig, um später in der Phase der Sachprüfung beurteilen zu können, ob die Erfindung nicht nur neu, sondern auch erfinderisch ist. Als Abschluss wird ein Recherchenbericht verfasst, der dem/der Anmelder:in zugeht. Unter Berücksichtigung der darin zitierten Dokumente muss dieser dann entscheiden, ob sich die Weiterverfolgung seiner/ihrer Idee lohnt – denn das weitere Verfahren ist auch mit zusätzlichen Gebühren verbunden.
Nur eine Kombination von Altbekanntem?
Die zweite Phase der Arbeit des/der Prüfer:in ist die Sachprüfung. Dazu muss dem/der Anmelder:in zunächst schriftlich mitgeteilt werden, welche Gründe eventuell gegen eine Patenterteilung sprechen. So kann es sein, dass die angemeldete Erfindung zwar Neues enthält, sich aber nur in winzigen Nuancen von bereits Bekanntem unterscheidet. Um zu entscheiden, ob diese Nuancen eine erfinderische Tätigkeit begründen, muss sich der/die Prüfer:in in die Rolle einer Rechtsperson versetzen, die im amtlichen Sprachgebrauch als skilled person, Fachmann oder homme du métier bezeichnet wird. Es wird angenommen, dass dieser fiktiven Person alle fachlich relevanten Dokumente bekannt sind, die zum Zeitpunkt der Anmeldung öffentlich zugänglich waren. Aus ihrer Sicht argumentiert der/die Prüfer:in nun, ob und wie die angemeldete Erfindung aus der Kombination von bereits Bekanntem offensichtlich gewesen wäre.
Expert:in mit der blauen Bibel
Das erfordert besonders viel Fingerspitzengefühl, denn im anschließenden Briefwechsel hat der/die Anmelder:in seinerseits/ihrerseits Gelegenheit, den/die Prüfer:in mit Argumenten von der Patentierbarkeit der Erfindung zu überzeugen. Das Ziel des Anmelders/der Anmelderin ist dabei, sich in allen denkbaren Anwendungsbereichen, in denen seine/ihre Erfindung in Zukunft eventuell eine Rolle spielen könnte, einen möglichst breiten Schutz vor Nachahmern zu sichern. Die Prüfbehörde muss demgegenüber das Interesse der Öffentlichkeit wahren und darauf achten, dass die Ansprüche nicht einen größeren Bereich abdecken als das, was sich vernünftigerweise unmittelbar aus der Erfindung ableiten lässt. Bei dieser Abwägung orientiert sich der/die Prüfer:in an der "blauen Bibel", dem Europäischen Patentübereinkommen, sowie an den einschlägigen Grundsatzentscheidungen der Beschwerdekammern, das heißt der zweit-instanzlichen Beschwerdegerichte des EPA. In Abwägung aller Argumente fällt die Prüfungsabteilung schließlich eine erstinstanzliche Entscheidung.
Exklusivrecht versus Patentgedanke
Nur selten wird eine Anmeldung rundweg abgelehnt, aber häufig bleibt vom ursprünglichen Anspruchssatz am Ende nur ein kleiner Teil übrig. Denn die Ansprüche begründen letztlich einen Rechtstitel, mit dem der/die Erfinder:in (innerhalb eines Territoriums und für einen gewissen Zeitraum) seinen/ihren Wettbewerber:innen die Nutzung der Idee verbieten kann. Wenn es darüber hinaus mit den nationalen Gesetzen vereinbar ist, begründet dies ein Exklusivrecht, die Erfindung zu vermarkten und auf diese Weise hohe Entwicklungskosten wieder einzuspielen. Es wäre aber unfair, wenn eine Einzelperson anderen die Nutzung einer Innovation verbieten könnte, ohne der Allgemeinheit durch Offenlegung die Chance zu geben, auf der Erfindung aufzubauen und sie weiterzuentwickeln. Diese Grundlage des Patentgedankens muss der/die Prüfer:in verteidigen.
Paragraphenreiter:in mit Jagdinstikt
Wer beim EPA arbeiten möchte, sollte Spaß an einer sehr präzisen Verwendung von Sprache haben, die Schnitzeljagd nach versteckten Hinweisen lieben und ein gewisses Faible für Paragraphen und Gesetzestexte mitbringen.
Im Patentamt sind gute Spürnasen gefragt
Während der Recherchephase muss man konzentriert und selbstständig arbeiten, braucht eine schnelle Auffassungsgabe und einen gewissen Jagdinstinkt, denn es gilt, aus einem Wust an Papieren möglichst rasch die relevanten Dokumente herauszufiltern, die belegen könnten, dass die angemeldete Erfindung nicht neu oder zumindest gegenüber bereits Bekanntem naheliegend ist.
Verantwortung für Erfinder:innen und Öffentlichkeit
In der Recherchephase ist genaues Lesen und logisches Argumentieren gefragt. Außerdem muss sich der/die Prüfer:in seiner/ihrer Verantwortung bewusst sein, denn er/sie agiert sowohl im Interesse der Öffentlichkeit wie auch des Anmelders/der Anmelderin – für keinen von beiden wäre es von Vorteil, wenn ein Patent für eine Erfindung erteilt würde, die de facto schon früher von jemand anderem gemacht wurde. Hier muss ein:e Prüfer:in unter Umständen Entscheidungen treffen, die für den/die Anmelder:in weitreichende – insbesondere finanzielle – Konsequenzen haben können. Dies ist ständige Herausforderung und Befriedigung zugleich. Ein besonderes, ja sogar erhebendes Gefühl ist es, wenn einem eines Tages ein Produkt im täglichen Leben wieder begegnet, für das man selbst das Patent erteilt hat.
Was müssen Bewerber:innen mitbringen?
Wer sich für eine Stelle als Prüfer:in interessiert, kann sich über die allgemeinen Voraussetzungen und das Bewerbungsprozedere gut unter www.epo.org informieren: Bewerber:innen müssen die Nationalität eines gegenwärtigen oder zukünftigen Mitgliedsstaates der Europäischen Patentorganisation haben, einen Hochschulabschluss besitzen, müssen eine der drei Amtssprachen Deutsch, Englisch und Französisch perfekt beherrschen und die anderen beiden verstehen und in ihnen kommunizieren können.
Achtung Einbahnstraße
Ein:e Bewerber:in sollte sich aber auch darüber im Klaren sein, dass er sich auf eine berufliche Einbahnstraße begibt: Für Naturwissenschaftler:innen ist es beispielsweise äußerst schwer, nach einiger Zeit beim EPA wieder in die angewandte Forschung zurückzugehen. Obwohl es in der Natur der Sache liegt, dass keine Anmeldung der anderen gleicht, spielt sich doch nach einiger Zeit eine gewisse Routine ein. Deshalb suchen sich viele Kolleg:innen außerhalb der Arbeit ein Ventil für die eigene Kreativität. Dafür eignen sich beispielsweise die zahlreichen und gut besuchten, vom EPA geförderten Clubs für diverse Hobbys und Aktivitäten, vom Tennisclub bis hin zum Haus- und Gartenverein.
Attraktive Zusatzleistungen
Das EPA bietet ein sehr attraktives Gehalt, das in den Mitgliedsstaaten nicht der nationalen Einkommensteuer unterliegt. Je nach persönlicher Situation des Prüfers/der Prüferin können weitere Zulagen hinzukommen, wie zum Beispiel eine Mietzulage. Darüber hinaus bietet das Amt ein sehr gutes Paket an Sozial- und Versicherungsleistungen, das unter anderem Kinderkrippen, eine private Krankenversicherung und eine kapitalgedeckte Alterssicherung umfasst, die von nationalen Vorsorgesystemen unabhängig ist. Zudem haben die Kinder der EPA-Bediensteten das Recht, die Europäische Schule in München zu besuchen. Nicht zu vernachlässigen sind auch die große Sicherheit des Arbeitsplatzes und die geregelten Arbeitszeiten.
Karrierewege im Europäischen Patentamt
Im EPA gibt es im Prinzip drei Arten von Karrieren: Man bleibt Prüfer:in und wird Spezialist:in in einem bestimmten technischen Bereich, man bewirbt sich und wird Mitglied in einer Beschwerdekammer, der zweiten Instanz am EPA, oder man wechselt ins Management. Da eine EPA-Karriere jedoch nicht nur von den persönlichen Fähigkeiten und vom Einsatzwillen, sondern auch von dem/der Dienstalter:in abhängt, kann es im Vergleich zur freien Wirtschaft bis zum nächsten Karriereschritt relativ lang dauern – in der Regel zehn Jahre und mehr. Zur Führung einer so vielseitigen Organisation wie dem EPA werden jedoch viele verschiedene Talente benötigt, sodass sich während der Arbeit als Prüfer:in immer wieder Gelegenheiten ergeben, auch in anderen Aufgaben und Projekten mitzuwirken.
Sollte man nach einiger Zeit beim EPA einen Wunsch nach beruflicher Veränderung verspüren, besteht natürlich auch die Möglichkeit, "die Seite zu wechseln" und als Patentanwältin bzw. Patentanwalt in einer Anwaltskanzlei oder der Patentabteilung eines Unternehmens zu arbeiten: Das EPA unterstützt und fördert auch die Ausbildung zum/zur europäischen Patentvertreter:in. Insgesamt ist das EPA ein sehr attraktiver Arbeitgeber, der neben einer fordernden und ausfüllenden Berufstätigkeit auch noch Zeit für Privates lässt.