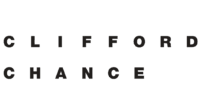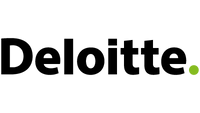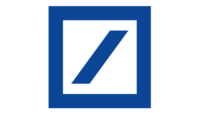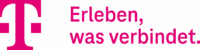Hier treffen sich die klügsten Köpfe: Hol das Beste aus Studium und Berufseinstieg heraus
Schon dabei? Hier einloggen
- Komm in Kontakt mit führenden Unternehmen und Top-Hochschulen
- Alle Jobs und Karriere-Events per Mail und in der App
- Uni-Kick: Recherche-Datenbanken, Stipendien, Fachliteratur
Exklusive Vorteile im Wert von 1.000 Euro für die besten 10 Prozent ihres Jahrgangs
Erkunde die Angebote für deinen Weg ins Berufsleben
Das empfehlen wir dir diese Woche
Studiengang
Masterstudiengang an der ESMT Berlin
Dein Studiengang für Unternehmertum und Business-Lösungen

Events für Studium und Berufseinstieg
Wann
Frühjahr und Herbst 2024
Der Einstieg ins Consulting für Berufserfahrene
Consulting-Events für Berufserfahrene

Dienstag
Das Karriereevent für Mediziner:innen und Naturwissenschaftler:innen
Perspektiven in Medizin und Human Health

Donnerstag
Infos und Kontake für einen erfolgreichen Einstieg
Perspektive Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung
![Entschlossener lächelnder Geschäftsmann mit Laptop auf Straße [Quelle: pexels.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Bilder-fuer-Newsletter/Bilder-fuer-Events-keine-Symbolbilder/_cardSmall/pexels-andrea-piacquadio-37710891.jpg)
Mittwoch
Deloitte Karriere-Event: Next stop Assurance
Karriere-Event: Next stop Assurance - Dein Einstieg als Consultant / Praktikant (m/w/d)






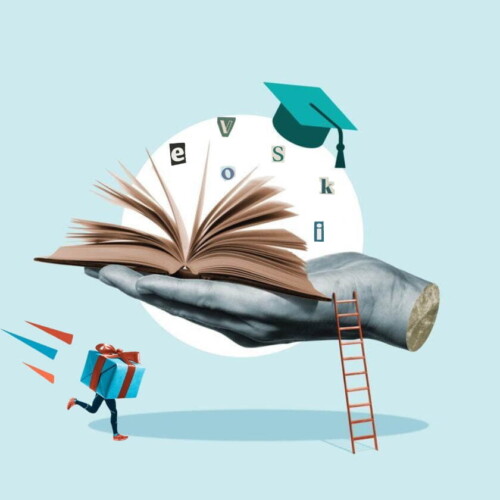



![Frankfurt am Main [Quelle: Pixabay]](https://www.e-fellows.net/uploads/ALT-Medienbibliothek/_Bilder/_cardSmall/Frankfurt-Skyline-Frankfurt-am-Main-Grossstadt-Wolkenkratzer-pixabay.com-1280x720.jpg)



![Junge Leute Gruppe Diskussion Meeting Laptops [pexels.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Bilder-fuer-Newsletter/Bilder-fuer-Events-keine-Symbolbilder/_cardSmall/pexels-fauxels-3182826.jpg)
![Team Hände Zusammenarbeit Teamwork [Quelle: pixabay.com, mohamed_hassan]](https://www.e-fellows.net/uploads/_cardSmall/teamwork-3213924_1920.jpg)


![Graduation Uni Abschluss USA Talar [© Monkey Business – Adobe Stock]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Bilder-fuer-Newsletter/Bilder-fuer-Events-keine-Symbolbilder/_cardSmall/Graduation-Uni-Abschluss-USA-Talar-Adobe-Stock-Monkey-Business.jpg)


![Studentin im Zoom-Meeting [© franz12 - stock.adobe.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Bilder-fuer-Newsletter/Bilder-fuer-Events-keine-Symbolbilder/_cardSmall/Studentin-Zoom-Meeting-Online-Vorlesung-Laptop-Adobe-Stock-1280x720_full_image.jpg)

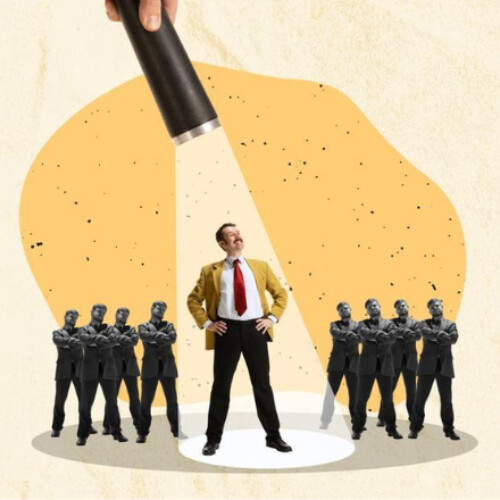
![Titelbild Wiwi-Stipendium [Quelle: Lesotre]](https://www.e-fellows.net/uploads/ALT-Medienbibliothek/_Bilder/_cardSmall/WiWi-Stipendium-WIWI-Stipendium-1280x720-e-fellows.net.jpg)
![Logo Ingenieurs-Stipendium [Quelle: Lesotre]](https://www.e-fellows.net/uploads/ALT-Medienbibliothek/_Bilder/_cardSmall/Ingenieurs-Stipendium-Titelbild-1280x720-e-fellows.net.jpg)